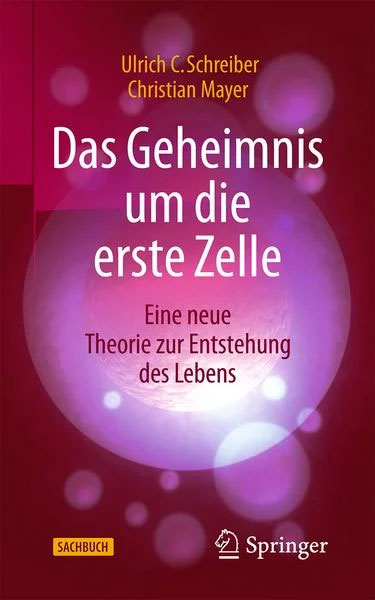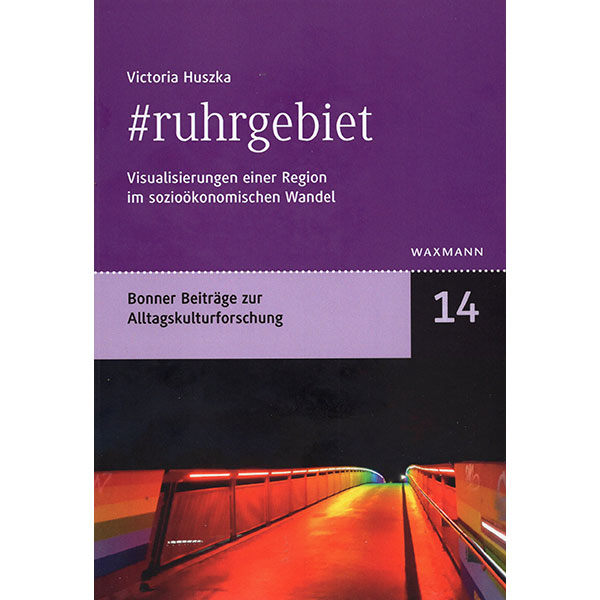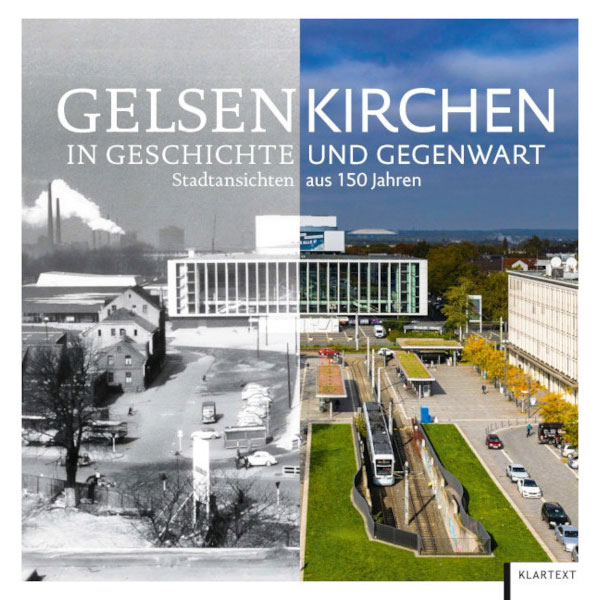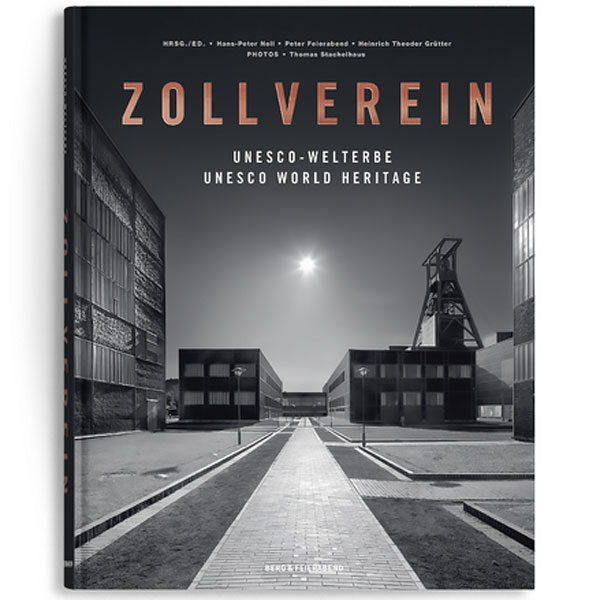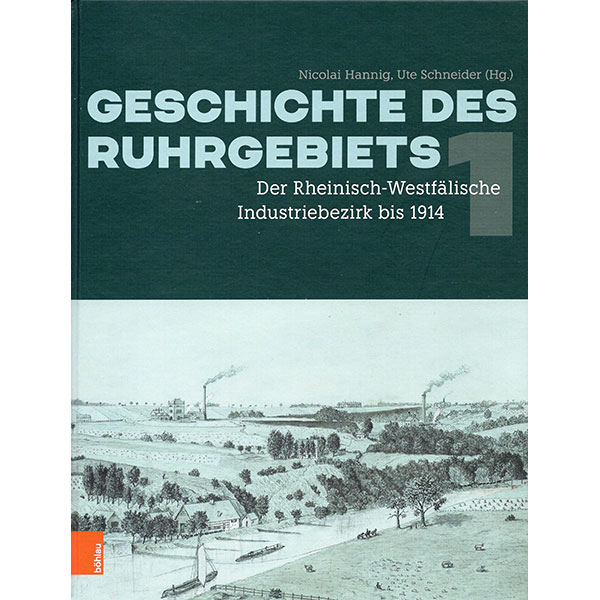Prof. Dr. Peter Pez Leuphana Universität, Lüneburg
Eine auf linearem Radwegebau an Hauptstrassen fokussierte Politik kann Radfahrer nur suboptimal fördern. Die Beseitigung von (Mikro-) Hindernissen für Netzdurchlässigkeit und die Schaffung analoger und digitaler Netztransparenz für Radrouten weisen den Weg in eine neue, flächige Vorgehensweise, die in einem Projekt im Modellvorhaben Rad des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr als public science partnership von Leuphana Universität und Landkreis Lüneburg aktuell eine Umsetzung findet.
Foto: Radverkehr in Kopenhagen (Heb via Wikimedia Commons, 2010, CC-BY-SA 3.0)
Exkursionsleitung: Thomas Högner und Friedrich Schulte-Derne
Exkursios Montag, 04.Mai bis Donnerstag 07. Mai 2026
Geplanter Ablauf: Stand 26.1.2026
Montag, 04.Mai:
- 09:00 Uhr: Fahrt von Essen HBF mit DB nach Detmold
- 12:00 Uhr: Ankunft Detmold
Fußweg zum Altstadthotel Detmold (ca. km) (Gepäckabgabe, ggf. Check in) - 14:00 Uhr: Aspekte zur Genese und Funktionalität Detmolds
(Fuß-Exkursion) - 17:30 Uhr: Ende des ersten Exkursionstages
Dienstag, 05. Mai:
- 09:00 Uhr: Fußweg zum LWL Freilichtmuseum Detmold
Haus-, Hof- und Dorfformen in Westfalen - 16:00 Uhr -18:00 Uhr individuelles Ende der Museumsbesichtigung
Mittwoch, 06. Mai:
09:00 Uhr: Busexkursion (ca. 190 km) nach
- Bückeburg (ehemalige Residenzstadt)
- Gernsheim (Industrie im ländlichen Raum)
- Hülshagen (Hagenhufensiedlung)
- Stadthagen („Leiterstadt“)
- Rinteln (eine geplante Stadt im Mittelalter)
Donnerstag, 07.Mai:
09:00 Uhr: Busexkursion (ca. 280 km) nach
- Lemgo (ehemalige Hansestadt)
- Minden (Wasserkreuz)
- Porta Westfalica (Weserdurchbruch)
- Lübbecke (Großes Torfmoor)
- Barkhausen (Saurierspuren)
- Versmold (Bifurkation)
xx:xx Uhr: Rückfahrt nach Essen (HBF)
Leistungen und Kosten:
Fahrt mit der DB von Essen nach Detmold, zwei Tage Busexkursion, Übernachtungen mit Frühstück im Altstadthotel Detmold, Eintrittsgelder, Exkursionsleitung
(keine Tages- und Abendverpflegung)
Pro Person: DZ € 385.- (mit D-Ticket) € 405.- (ohne D-Ticket)
EZ € 415.- (mit D-Ticket) € 435.- (ohne D-Ticket)
Achtung: Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen beschränkt!
Anmeldung bis zum 10.04.2026 mit der Angabe, ob D-Ticket vorhanden, ab sofort per Mail an:
thoegner@t-online.de
Nach Bestätigung ist eine Anzahlung von € 160.- pro Person fällig!
Für die Exkursionsleitung
Friedrich Schulte-Derne Thomas Högner
Liebe Mitglieder,
wir möchten Sie zu einer virtuellen Exkursion mit Prof. Dr. Ulrich Schreiber in die Vulkaneifel einladen.
Teil 1: Origin of Life: https://www.youtube.com/watch?v=lrktPdJ8VZA
Teil 2: Origin of Life https://www.youtube.com/watch?v=0OTZcG5JXF4
Bitte beachten Sie auch die folgende Vorankündigung (Erscheinungsdatum 30.5.2026):
Das Geheimnis um die erste Zelle: eine neue Theorie zur Entstehung des Lebens
Taschenbuch von Ulrich Schreiber/ Christian Mayer
Eine der größten Fragen der Wissenschaft steht vielleicht in naher Zukunft vor der Aufklärung. Wie und in welchem Umfeld ist das Leben auf der Erde entstanden?
Plausible Szenarien für die ersten Schritte auf dem Weg zum Leben können nur dann ausreichend beschrieben werden, wenn der Umgebungsraum bekannt ist, in dem die Entwicklungen stattgefunden haben. Aus geologischer Sicht boten beste Voraussetzungen für die Entstehung der ersten Zellen tief reichende, wassergefüllte Spalten der frühen kontinentalen Erdkruste, die auch heute noch alle Anforderungen für eine komplexe organische Chemie erfüllen.
Der Erstautor nimmt seine Leser mit auf seine ganz persönliche Reise hin zur Antwort auf die vielleicht größte Frage der Biologie. So erklärt er nicht nur wie die einzelnen Puzzleteile der Entwicklung des Lebers zusammenpassen, sondern berichtet über seine persönlichen Erfahrungen in diesem schwierigen Forschungsfeld. Während die ersten sieben Kapitel in der 2. Auflage nur überarbeitet wurden, ist das achte Kapitel vollständig neu konzipiert. Hierin wird in einer logischen Verknüpfung der bislang bekannten Fakten unter Berücksichtigung heutiger biochemischer Zusammenhänge ein Weg aufgezeigt, der zur Speicherung genetischer Informationen in einer ersten Zeile geführt haben kann.
Mit Kap. neun und zehn sind zwei zusätzliche Beiträge von Christian Mayer ergänzt. Hierin eröffnet er eine grundlegende Diskussion über de Definition "Was ist Leben", indem er die Beziehung von Ordnung und Komplexität in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus beschreibt er die Bedeutung periodisch auftretender Einflüsse auf die gesamte Entwicklung des Lebens.