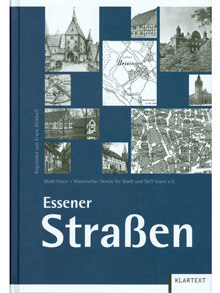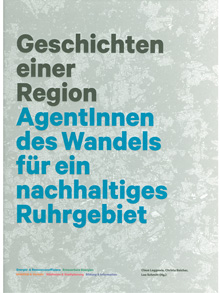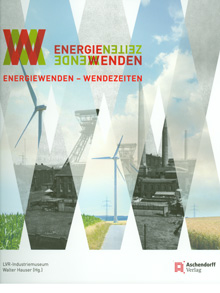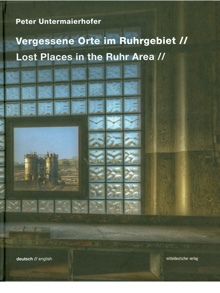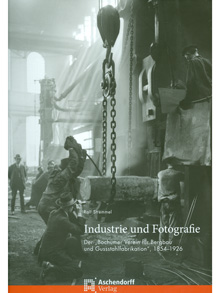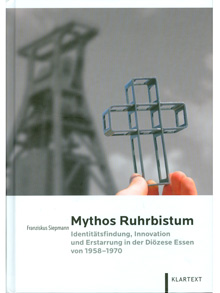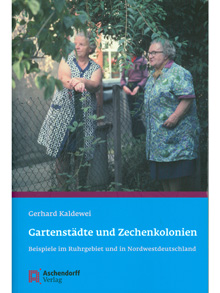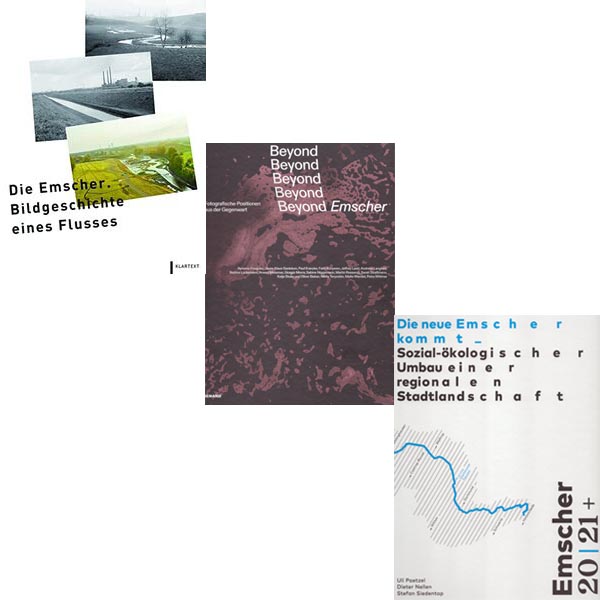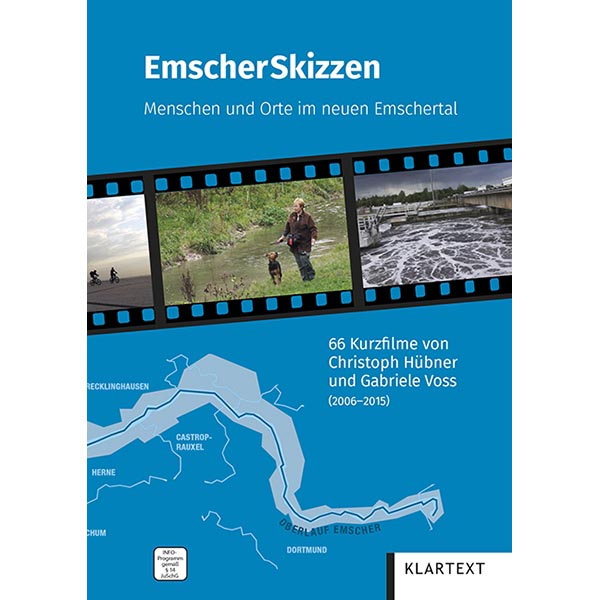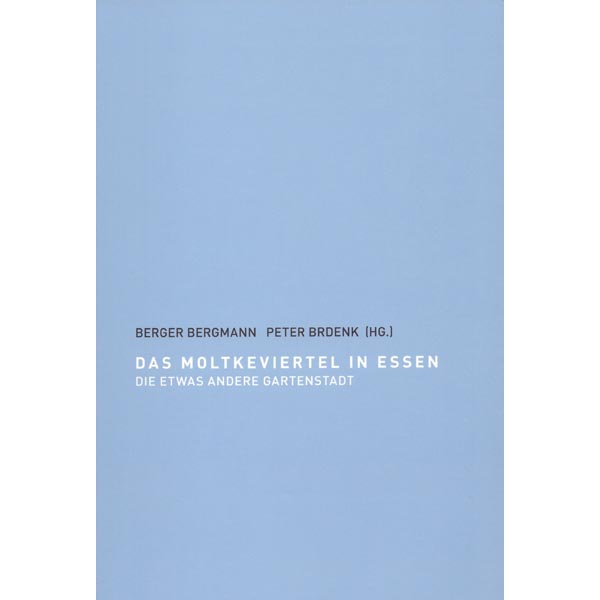Schlösser, Burgen und Ruinen. Historische Gemäuer und ihre Geschichte im und um das Ruhrgebiet.
Schürmann, Maren/Georg Howahl. Essen (Klartext) 2018, 160 S., ISBN 978-3-8375-1931-0, € 14,95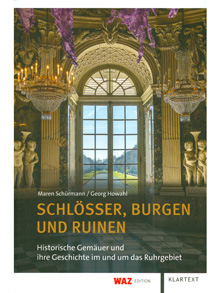 Diese Sammlung von 41 Reportagen über Schlösser und Burgen im Ruhrgebiet und am Niederrhein ist – wie schon einige Bücher der WAZ Edition zuvor – die Zusammenfassung von WAZ-Zeitungsartikeln. Dabei geht es nicht um tiefschürfende historische Darstellungen, sondern jede Lokalität wird hinsichtlich ihrer touristischen Erschließung und Attraktivität (Parkmöglichkeiten, Haltestelle, Begehbarkeit, touristische Besonderheiten, Gastronomie, Kontaktdaten) vorgestellt. Weiterhin werden die Objekte hinsichtlich ihrer geschichtlichen und/oder baulichen Besonderheit bzw. Ihrer Neunutzung charakterisiert, und dies fast immer mit Bezug auf Personen, die heute mit dem jeweiligen Objekt familiär, beruflich oder ehrenamtlich verbunden sind. Gut bebildert will dieses Buch Lust machen, die Relikte der vorindustriellen Geschichte der Region kennen zu lernen; als solches sollte es in die Hand genommen und genutzt werden.
Diese Sammlung von 41 Reportagen über Schlösser und Burgen im Ruhrgebiet und am Niederrhein ist – wie schon einige Bücher der WAZ Edition zuvor – die Zusammenfassung von WAZ-Zeitungsartikeln. Dabei geht es nicht um tiefschürfende historische Darstellungen, sondern jede Lokalität wird hinsichtlich ihrer touristischen Erschließung und Attraktivität (Parkmöglichkeiten, Haltestelle, Begehbarkeit, touristische Besonderheiten, Gastronomie, Kontaktdaten) vorgestellt. Weiterhin werden die Objekte hinsichtlich ihrer geschichtlichen und/oder baulichen Besonderheit bzw. Ihrer Neunutzung charakterisiert, und dies fast immer mit Bezug auf Personen, die heute mit dem jeweiligen Objekt familiär, beruflich oder ehrenamtlich verbunden sind. Gut bebildert will dieses Buch Lust machen, die Relikte der vorindustriellen Geschichte der Region kennen zu lernen; als solches sollte es in die Hand genommen und genutzt werden.- 14. September 2018
- 1 Min Read
Die Ruhmeshalle des Ruhrgebiets. 101 bemerkenswerte Biografien.
Berke, Martin. Düsseldorf (Droste) 2016, 248 S., ISBN 978-3-7700-1597-9, € 16,99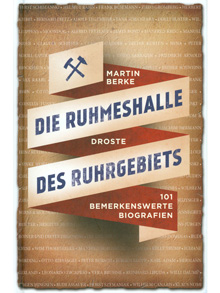 Die Geschichtsschreibung der industriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets hat verschiedene Bände mit den Biographien von Persönlichkeiten dieser Periode hervorgebracht, manche bedeutend, etliche mittlerweile vergessen, einige nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Diese Sammlung von Biographien ist anders. In 16 thematischen Kapiteln werden 101 Personen – von Friedrich Arnold Brockhaus bis Dolly Buster -, Figuren wie Alfred Tetzlaff oder Adolf Tegtmeier, Familien oder Gruppen – wie die Krupps oder der BVB porträtiert, wobei Charakteristisches Vorrang vor Biographischem hat. Manche der Darstellten sind irgendwo im Ruhrgebiet geboren, andere hier gestorben; etliche haben es nur gestreift, aber einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie erfanden die Dehnbundhose und den Oberinspektor Derrick, schenkten der Welt die Currywurst und 99 Luftballons oder brachten Ordnung in die deutsche Sprache. Martin Berke hat eine vergnügliche Sammlung von „Biographien“ zusammengestellt, wobei jeweils die überraschende Neuigkeit, die Kuriosität oder einfach unnützes Wissen ein wichtiges Auswahlkriterium gewesen zu sein scheint. Leicht bis schnodderig sind auch der Stil und das Layout des Buches, wenngleich man über einige gewollt witzige Zwischenüberschrift diskutieren kann.
Die Geschichtsschreibung der industriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets hat verschiedene Bände mit den Biographien von Persönlichkeiten dieser Periode hervorgebracht, manche bedeutend, etliche mittlerweile vergessen, einige nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Diese Sammlung von Biographien ist anders. In 16 thematischen Kapiteln werden 101 Personen – von Friedrich Arnold Brockhaus bis Dolly Buster -, Figuren wie Alfred Tetzlaff oder Adolf Tegtmeier, Familien oder Gruppen – wie die Krupps oder der BVB porträtiert, wobei Charakteristisches Vorrang vor Biographischem hat. Manche der Darstellten sind irgendwo im Ruhrgebiet geboren, andere hier gestorben; etliche haben es nur gestreift, aber einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie erfanden die Dehnbundhose und den Oberinspektor Derrick, schenkten der Welt die Currywurst und 99 Luftballons oder brachten Ordnung in die deutsche Sprache. Martin Berke hat eine vergnügliche Sammlung von „Biographien“ zusammengestellt, wobei jeweils die überraschende Neuigkeit, die Kuriosität oder einfach unnützes Wissen ein wichtiges Auswahlkriterium gewesen zu sein scheint. Leicht bis schnodderig sind auch der Stil und das Layout des Buches, wenngleich man über einige gewollt witzige Zwischenüberschrift diskutieren kann. - 14. September 2018
- 1 Min Read
111 Orte im Ruhrgebiet, die man gesehen haben muss. Band und 2
Fabian Pasalk. Neuauflage, Köln (Emons-Verlag) 2017, 240 S., ISBN 978-3-89705-814-9, € 16,95 Fabian Pasalk Band 2, Neuauflage, Köln (Emons-Verlag) 2016, 240 S., ISBN 978-3-95451-223-2, € 16,95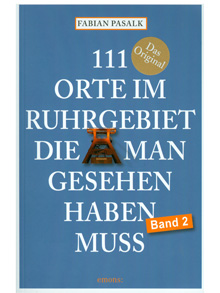 Wenn Sie nicht (nur) Industriekultur besuchen wollen, wenn Sie schon dem Rat von Historikern und Archäologen gefolgt sind, dass es im Ruhrgebiet auch Orte der vorindustriellen Geschichte gibt, und keine Schlösser und Burgen mehr besuchen wollen, wenn sie auch nicht unbedingt nur nach Standorten von Merkwürdigkeiten suchen, dann folgen Sie doch diesen beiden Büchern und ihren Vorschlägen aus einem breiten Spektrum von Ruhrgebietsnatur, Alltagsleben, Geschichte, Technik und Kunst und finden Sie Spektakuläres aus der zweiten Reihe, Überraschendes, Liebenswertes oder Orte, von deren Existenz Sie wussten, an denen Sie aber noch nie waren (hier einige Beispiele von 222): auf dem Europaplatz von Castrop-Rauxel, in der Dortmunder Schwebebahn, beim Hebeturm des Rheintrajekts in Homberg, an der Halde Zollverein I/II, in den Bergsenkungen im Königreich Beisen, auf der Korte-Klippe, in der Schalker Glückauf-Kampfbahn, in der Heilig-Kreuz-Kirche (Gelsenkirchen-Ückendorf) am Solarbunker (Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen), im Hagener Hohenhof, an den Hügelhäusern von Marl-Drewer, in der Mülheimer Straße der Millionäre, an der Fossa Eugeniana (Rheinberg), im chinesischen Garten (Bochum-Querenburg), im Currywurst-drive in von Dorsten, im Magnetmuseum (Dortmund-Aplerbeck), in der Hochzeitsmeile von Marxloh, im Bergmannsdom (Essen-Katernberg), zwischen den Baumskulpturen an Schloss Berge (Gelsenkirchen-Buer), auf der Fleuthebrücke (Gelsenkirchen-Resser Mark) oder im Gethmann’schen Garten in Hattingen. Für alle 222 Lokalitäten werden die Anreisewege mit dem eigenen Pkw und dem ÖPNV angegeben sowie Tipps über Interessantes in der Umgebung; hinzu tritt in jedem der uneingeschränkt empfehlenswerten Bände eine Übersichtskarte.
Wenn Sie nicht (nur) Industriekultur besuchen wollen, wenn Sie schon dem Rat von Historikern und Archäologen gefolgt sind, dass es im Ruhrgebiet auch Orte der vorindustriellen Geschichte gibt, und keine Schlösser und Burgen mehr besuchen wollen, wenn sie auch nicht unbedingt nur nach Standorten von Merkwürdigkeiten suchen, dann folgen Sie doch diesen beiden Büchern und ihren Vorschlägen aus einem breiten Spektrum von Ruhrgebietsnatur, Alltagsleben, Geschichte, Technik und Kunst und finden Sie Spektakuläres aus der zweiten Reihe, Überraschendes, Liebenswertes oder Orte, von deren Existenz Sie wussten, an denen Sie aber noch nie waren (hier einige Beispiele von 222): auf dem Europaplatz von Castrop-Rauxel, in der Dortmunder Schwebebahn, beim Hebeturm des Rheintrajekts in Homberg, an der Halde Zollverein I/II, in den Bergsenkungen im Königreich Beisen, auf der Korte-Klippe, in der Schalker Glückauf-Kampfbahn, in der Heilig-Kreuz-Kirche (Gelsenkirchen-Ückendorf) am Solarbunker (Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen), im Hagener Hohenhof, an den Hügelhäusern von Marl-Drewer, in der Mülheimer Straße der Millionäre, an der Fossa Eugeniana (Rheinberg), im chinesischen Garten (Bochum-Querenburg), im Currywurst-drive in von Dorsten, im Magnetmuseum (Dortmund-Aplerbeck), in der Hochzeitsmeile von Marxloh, im Bergmannsdom (Essen-Katernberg), zwischen den Baumskulpturen an Schloss Berge (Gelsenkirchen-Buer), auf der Fleuthebrücke (Gelsenkirchen-Resser Mark) oder im Gethmann’schen Garten in Hattingen. Für alle 222 Lokalitäten werden die Anreisewege mit dem eigenen Pkw und dem ÖPNV angegeben sowie Tipps über Interessantes in der Umgebung; hinzu tritt in jedem der uneingeschränkt empfehlenswerten Bände eine Übersichtskarte. - 15. Januar 2018
- 2 Min Read
Raumstrategien Ruhr 2035+. Konzepte zur Entwicklung der Agglomeration Ruhr.
Jan Polivka/Christa Reicher/Christoph Zöpel (Hg.) Dortmund (Verlag Kettler) 2017, 296 S., ISBN 978-3-86206- 678-0, € 39,90 Zu diesem gewichtigen Buch gibt es einige Vorläufer, der wohl wichtigste ist der 2011 erschienene Analyseband „Schichten einer Region – Kartenstücke zur räumlichen Struktur des Ruhrgebiets“. Der Analyse folgt mit diesem Buch der Planungs- oder Perspektiventeil. Der aktuellen Planungsdiskussion entsprechend gliedert sich der Band nach einer Einleitung in die Themenkapitel „Wohnkultur und Siedlungsstruktur“, “Flächenbedarf der Wirtschaft“, „Netze für die urbane Mobilität“, „Landschaft und Infrastruktur“, „Struktur der Energieversorgung“, „Steigerung der Lebensqualität“ und „Bildung und Integration“, alle ausgestattet mit aussagekräftigen Karten und Graphiken. Darauf aufbauend zeigen die drei Herausgeber 14 komplementäre Zukunftswege für die Agglomeration Ruhr auf, wobei sie von der industriehistorisch bedingten „ruhrbanen Kulturlandschaft“ ausgehen und zur Realisierung der verschiedenen Sachziele eine „institutionelle Existenz und Verfasstheit“ für die Region fordern, um die letztendlichen Ziele „Integration“, „Innovation“ und „Internationalisierung“ zu erreichen. In Weiterführung der regionalen Analyse von 2011 wird mit diesem Buch ein modernes integratives Planungskonzept für das Ruhrgebiet vorgelegt.- 15. Januar 2018
- 1 Min Read
Essener Straßen.
Stadt Essen/Historischer Verein für Stadt und Stift Essen e.V. Essen (Klartext-Verlag) 2015, 387 S., ISBN 978-3-8375-0848-2, € 19,95Essener Köpfe.
Stadt Essen/Historischer Verein für Stadt und Stift Essen e.V. Essen (Klartext-Verlag) 2015, 400 S., ISBN 978-3-8375-0849-9, € 19,95 Dies ist keine Buchrezension, sondern eine wichtige, wenngleich etwas verspätete Buchanzeige. 1979 und 1985 erschienen erstmals „Essener Straßen“ und „Essener Köpfe“, herausgegeben von Erwin Dickhoff. Sie wurden zu lokalhistorischen Standardwerken; schon Ende des vergangenen Jahrhunderts waren aktuelle Neuauflagen Desiderate. Die Stadt Essen und der Historische Verein besorgten diese nun 2015. „Essener Straßen“ ist dabei um 205, seit 1979 hinzugekommene Straßen gewachsen, die „Essener Köpfe“ haben sich auf der Basis von Vorschlägen aus der Öffentlichkeit um 282 vermehrt. Damit liegen allen lokal Forschenden und Interessierten zwei wichtige qualitätsvolle Nachschlagwerke in aktueller Form vor.- 15. Januar 2018
- 1 Min Read
Geschichten einer Region. AgentInnen des Wandels für ein nachhaltiges Ruhrgebiet.
Claus Leggewie/Christa Reicher/Lea Schmitt (Hg.) Dortmund (Verlag Kettler) 2016, 335 S., ISBN 978-3-86206-607-0, € 29,90 Die Umsetzung des Weltklimaabkommens ist nicht nur durch eine „einfache“ Energiewende zu erreichen. Um ökologisch, sozial und politisch nachhaltige Strukturen und Handlungsroutinen zu erreichen, sind umfassende Umgestaltungen, vor allem in den Bereichen Mobilität, Ressourcen- und Energieverbrauch, Landwirtschaft und Stadtentwicklung notwendig. Für den Erfolg der Umsetzung sind die Berücksichtigung der regionalen/lokalen Eigenart, des lokalen nachhaltigen Umgangs mit Umweltproblemen und die spezifische Form der Teilhabe entscheidend. Vor diesem Hintergrund gliedert sich die Veröffentlichung in die Abschnitte „Energie & Ressourceneffizienz“, „Erneuerbare Energien“, „Mobilität & Verkehr“, „Städtebau & Stadtplanung“ und „Bildung & Information“. In jedem dieser Felder des Wandels werden bereits in der Region vorhandene Aktionen und Organisationen vorgestellt; ergänzt werden diese durch informative Karten und Graphiken. Auf diese Weise wird ein interessanter Überblick über die bereits vorhandenen, an den eingangs aufgezeichneten Zielen orientierte Grassroot-Aktivitäten gegeben. Die Antwort, auf welche Weise und mit welchem Ziel es davon ausgehend zu einem umfassen, komplexen regionalen Verbund kommen soll, die Eigenart, Nachhaltigkeit und Teilhabe berücksichtigt, bleibt das Schlusskapitel schuldig. Hier wird lediglich auf die rechtlichen Möglichkeiten eines demokratisch verfassten Regionalverbandes hingewiesen und gefordert, die Unternutzung ihrer Polyzentralität, d.h. das Kirchturmdenken zu überwinden.- 15. Januar 2018
- 2 Min Read
Energiewenden – Wendezeiten.
LVR-Industriemuseum/Walter Hauser (Hg.) Münster (Aschendorff) 2017. 186 S., ISBN 978-3-402-13258-6, € 17,90 Passend zur Stilllegung von Prosper II und damit dem Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet sowie mit der gleichzeitigen Schließung des Bergwerks Ibbenbüren und damit dem Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland zeigt das LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg vom 20.10.2017 bis zum 28.10.2018 unter dem obigen Titel eine Ausstellung; der vorliegende Band ist der Ausstellungskatalog. Zunächst werden die verschiedenen primären und sekundären Energieträger in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und in ihrer prägenden Wirkung auf die Kulturlandschaft im Zuge der verschiedenen energetischen Transformationen dargestellt. Dem folgt eine eingehende Betrachtung der Energielandschaft NRW, bevor über eine Ausweitung auf die globale Dimension die Notwendigkeiten und Formen der Energiewende analysiert werden, die ohne Digitalisierung und dezentrale Konzepte nicht möglich ist. Smarte und dezentrale Visionen eröffnen neue Fragestellungen und Visionen; in den hoch entwickelten Ländern mag der Prosumer, der Energie produziert wie verbraucht, eine Realität werden, wie die Mehrzahl der Menschheit jedoch an eine nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung angebunden werden kann, gehört noch zu den zu lösenden Problemen. Eingestreut in dieses Konzept sind Interviews und Gastbeiträge zu verschiedenen aktuellen Fragestellungen der Energiewende. Ausstellungen und Bücher sind grundsätzlich unterschiedliche Formen der Informationsvermittlung; in diesem Fall bietet sich die Chance, sie ergänzend zu benutzen. Wer es in die Ausstellung nicht schafft, an diesem wichtigen Thema jedoch interessiert ist, greife zu dieser gleichermaßen fundiert wie ansprechend gemachten Veröffentlichung.- 15. Januar 2018
- 2 Min Read
Vergessene Orte im Ruhrgebiet/Lost Places in the Ruhr Area.
Peter Untermaierhofer Halle (Mitteldeutscher Verlag) 2013, 160 S., ISBN 978-3-95462-105-7, € 24,95 Dieses Buch ist ein schöner Bildband über alte Industrieanlagen im Ruhrgebiet im besenreinen Schwebezustand zwischen aufgegebener alter Nutzung und (noch nicht gefundener) neuer Nutzung. Der Titel ist ein geschmäcklerischer Unsinn; denn die vorgestellten Orte sind keineswegs unvergessen, sondern in vielen Fällen feste Bestandteile der regionalen Industriekultur. Dies wird auch in einigen der beigegebenen Texte von Thomas Parent deutlich. In diesem Zusammenhang wäre es auch hilfreich gewesen, wären den Fotos die Aufnahmedaten beigegeben worden. Aber hier geht es weniger um textliche Information als vielmehr um das besondere Bild. Für diejenigen also, die nicht auf der Suche nach vordergründigem Hochglanz sind, sondern hinsichtlich Motivwahl, Stimmung und Farbgebung die etwas anderen Fotos von ausrangierten Industrieanlagen suchen, ist dieses Buch eine gute Wahl.- 15. Januar 2018
- 1 Min Read
Industrie und Fotografie. Der „Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation“, 1854-1926.
Ralf Stremmel Münster (Aschendorff Verlag) 2017, 248 S., ISBN 978-3-402-13213-5, € 29,95 Der Bochumer Verein gehörte einst zu den größten montanindustriellen Unternehmen Deutschlands. Nahezu von Beginn an betrieb er eine ausgeprägte und vielseitige Werksfotografie. 125000 Aufnahmen sind im Historischen Archiv Hügel überliefert. Aus diesen wurden 236 Motive aus der Zeit von der Gründung bis zur Eingliederung in die Vereinigten Stahlwerke ausgewählt. Der Stil des Buches kopiert alte Firmenchroniken und umfasst textlich und fotografisch verschiedenste Aktivitätsbereiche des Unternehmens – Entwicklungsgeschichte, Beschäftigte, soziale Einrichtungen, Sicherheit und Arbeitsschutz, Produktion und Produkte (Vom Eisen über Stahl zum Endprodukt; Glocken, Maschinen und Kanonen; Fahrzeug und Fahrzeugteile; Zechen und andere Tochterbetriebe), Hilfs- und Nebenbetriebe, Wissensbetriebe, Anlagen außerhalb der Werkstore. Der Reiz des Buches liegt zum einen in der umfassenden Fotodokumentation des BV in der angegebenen Phase, zum anderen in der Tatsache, dass die Mehrzahl der Fotos erstmalig veröffentlicht werden.- 15. Januar 2018
- 1 Min Read
Mythos Ruhrbistum. Identitätsfindung, Innovation und Erstarrung in der Diözese Essen von 1958-1970.
Franziskus Siepmann Essen (Klartext) 2017, 655 S., ISBN 978-3-8375-1454-4, € 39,95 „Das Bistum ist errichtet. Ich bin jetzt hier gleichsam vor Ort gegangen. In Gottes Namen wollen wir die erste Schicht verfahren.“ (Bischof Franz Hengsbach, 1958) – „Ich bin nicht mehr der Bischof der Bergarbeiter“ (Bischof Franz-Josef Overbeck, 2013). Diese beiden Zitate markieren den Beginn und den bisherigen Endpunkt des Bistums Essen. Es wurde gegründet als Arbeiterbistum, in dem die Arbeiterseelsorge grundlegend werden sollte. Dieses Ziel bestimmte die Wahl des ersten Bischofs ebenso wie die Aufbruchsstimmung des ersten Jahrzehnts, die sich in Kirchenneubauten und Pfarreigründungen manifestierte. Ein engmaschiges Netz der kirchlichen Organisation sollte eine – heute als antiquiert angesehene – paternalistische Arbeiterseelsorge ermöglichen. Bereits im Gründungsjahr 1958 begannen jedoch die sozio-ökonomischen Bedingungen, in die das Bistum hineingegründet worden war, wegzubröckeln. Je weiter der sogenannte Strukturwandel voranschritt, wurde das Ruhrbistum als katholisch-organisatorisches Gegenstück zum Ruhrgebiet ein Mythos. Als Anwalt der Arbeiter begleitete der im Grunde konservative erste Bischof Franz Hengsbach als Mittler zwischen den sozialpolitischen Fronten diesen Wandlungsprozess. Die tiefgreifenden kulturellen, gesellschaftlichen und – im Gefolge des II. Vatikanums – kirchlichen Umbrüche seit den 1960er Jahren vermochte das Bistum jedoch nur zögerlich durch Antworten und neue Seelsorgekonzepte zu begleiten. Interne Auseinandersetzungen führten zu einer gewissen Paralysierung. Die zunehmende Entfremdung der Katholiken von ihrer Kirche und der Rückgang der Priesterberufungen macht das eingangs geschaffene enge pastorale Netzwerk zunehmend überflüssig und bis in die Gegenwart auch nicht mehr finanzierbar. Die besondere Geschichte dieses Bistums scheint noch immer in die Gegenwart durch, seine Positionierung in einem gewandelten Ruhrgebiet der Zukunft ist aber noch zu finden. Ein in jeder Hinsicht gewichtiges und empfehlenswertes Buch.- 15. Januar 2018
- 2 Min Read
Gartenstädte und Zechenkolonien. Beispiele im Ruhrgebiet und in Nordwestdeutschland.
Gerhard Kaldewei Münster (Aschendorff) 2018, 199 S., ISBN 978-3-402-13275-3, € 39,90 Dieses Buch, verfasst vom ehemaligen Leiter des Nordwestdeutschen Museums für IndustrieKultur in Delmenhorst, ist ein schwieriges. Es ist der Versuch, industrielles Wohnen im Ruhrgebiet und, mit dem Beispiel Delmenhorst, im westfälischen Textilgebiet in den historischen Rahmen sich wandelnder gesellschaftlicher Bedingungen und sich entwickelnder architektonisch-städtebaulicher Konzepte zu analysieren und zu bewerten. Dies geschieht in den drei Kapiteln „Von der Lebensform zur Gartenstadtbewegung“, „Werkbund, Heimatbewegung, Zechenkolonien“ und „Industriekultur“; eingestreut in diese Kapitel sind Exkurse, in denen fünf Siedlungen in ihrer historischen Entwicklung präsentiert werden. Die Arbeit basiert auf einem recht umfangreichen Literaturverzeichnis, mit dem Schwerpunkt vor 2000; von den eigenen (nicht historischen!) Fotos, die die aktuelle Struktur der Siedlungen verdeutlichen soll, sind nur etwa fünf jünger als 1990. Zusätzlich zu dieser „angestaubten“ Anmutung wird die Intention des Autors nicht klar, zum einen weil es weder eine entsprechende Einführung, noch ein wertendes Schlusskapitel gibt, zum anderen weil er sich, außer bei den Sachdarstellungen der Exkurse, fast gänzlich hinter einer hohen Dichte von Zitaten versteckt. Damit gelingt es, eine weitgehend sachgerechte Kompilation zu erstellen, wenngleich die Auswahl der Siedlungen die Tendenzen vorgibt, zugleich aber auch wieder die sattsam bekannten Fehler produziert; Eisenheim entsteht in der „Ödnis“ des späteren „nordamerikanischen“ Oberhausen, Osthaus‘ Hohenhagen ist zu Recht eine herausragende Antithese, die Delmenhorster Nordwolle-Kolonie steht für paternalistische Gesinnungen einiger Industrieller, für die Überhöhung der Gartenstadtidee wird einmal mehr fälschlicherweise, weil von Metzendorf ausdrücklich abgelehnt, die Margarethenhöhe vereinnahmt; als Beispiel für die hundert „Normalfälle“ steht die Kolonie Maximilian in Hamm. Alles, was in dieser Kompilation abgehandelt wird, ist bereits bekannt und häufig besser dargestellt worden. Im letzten Kapitel macht sich zudem die Außensicht des Autors bemerkbar; diese ist nicht – wie sie es sein könnte inspirierend, sondern führt zu Fehleinschätzungen, z.B. über die IBA, oder – wieder versteckt hinter ausgewählten Zitaten gar zu Häme, z.B. über die Kulturhauptstadt und über den Identität stiftenden und ökonomischen Wert der Industriekultur. Hier hätte der Autor besser eine differenzierte Diskussion über das labile Gleichgewicht zwischen der Identifikation mit und einer kritischen Distanz zur Region und ihrem industriekulturellen Erbe führen sollen; genügend Quellen für Zitate hätte er dazu gefunden.- 15. Januar 2018
- 2 Min Read