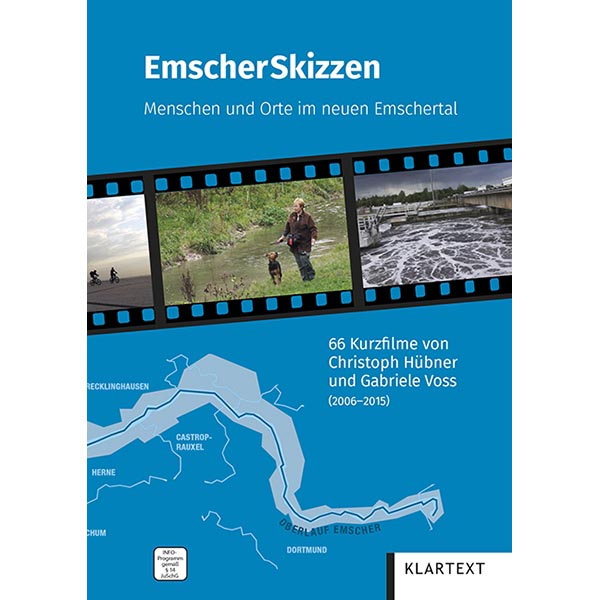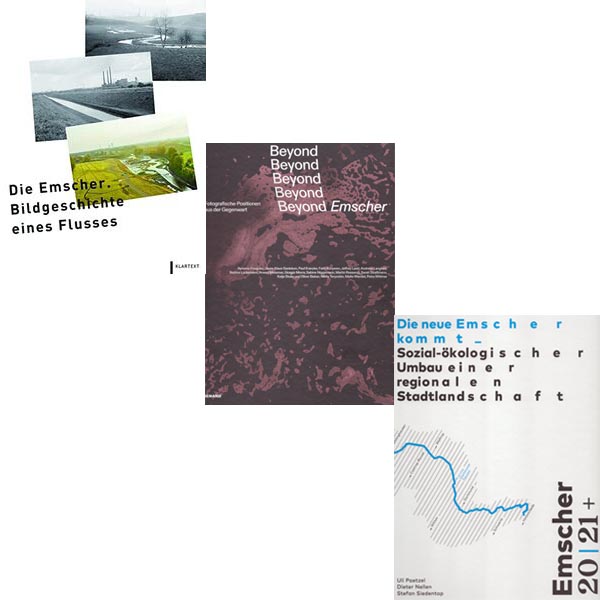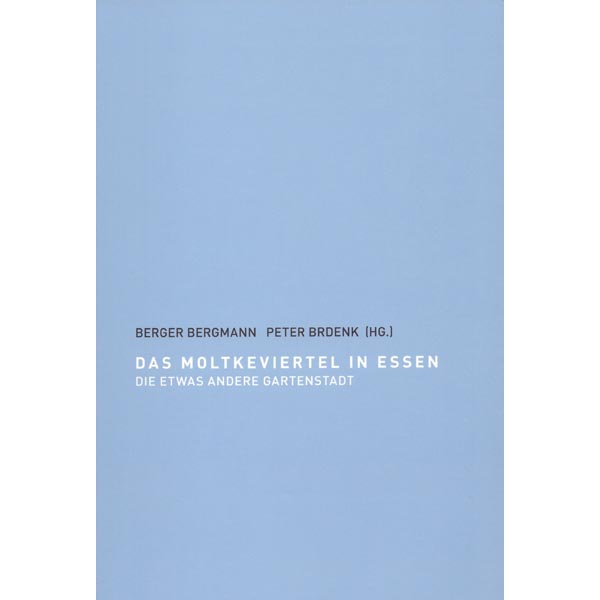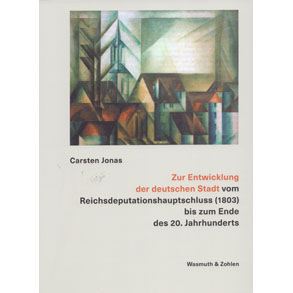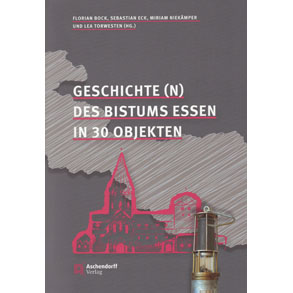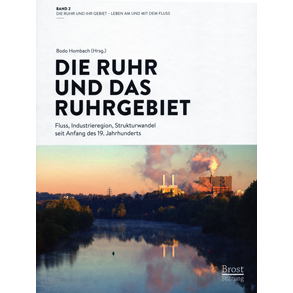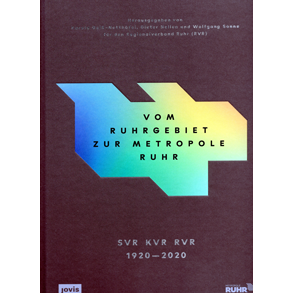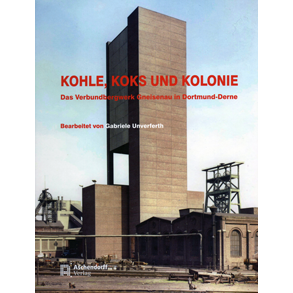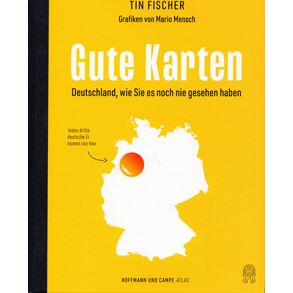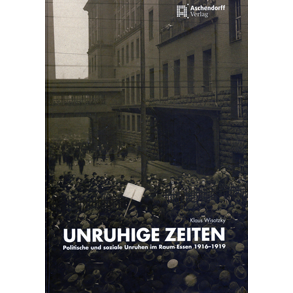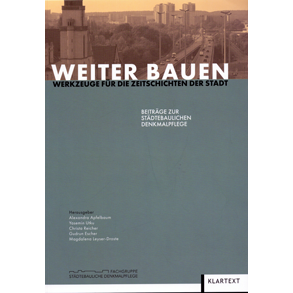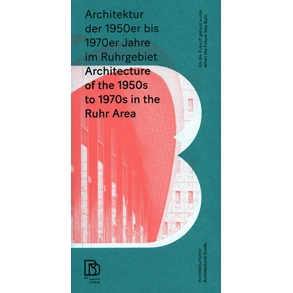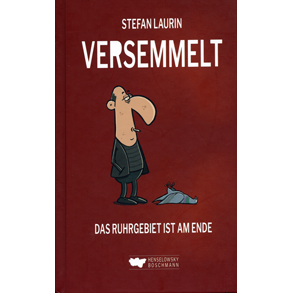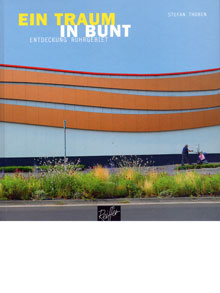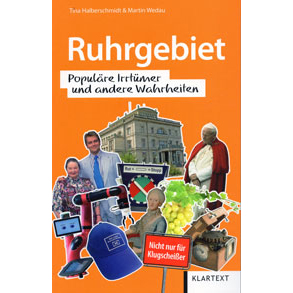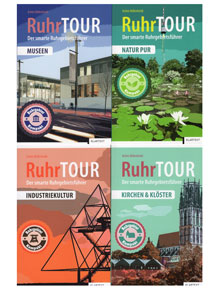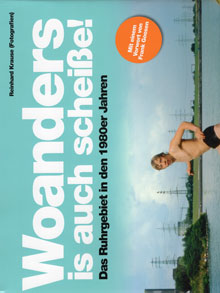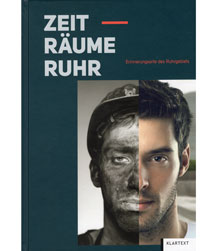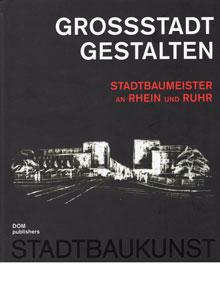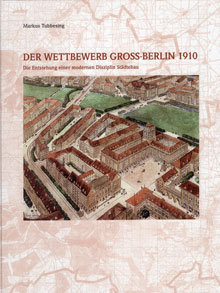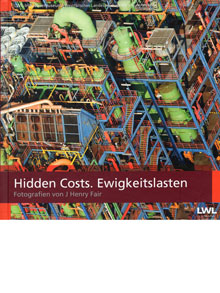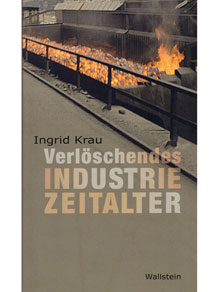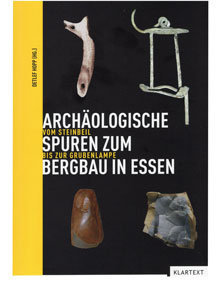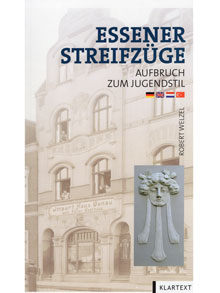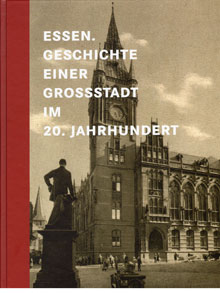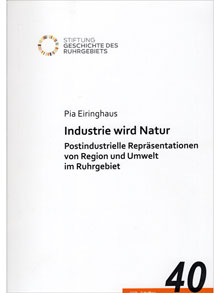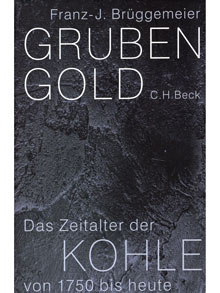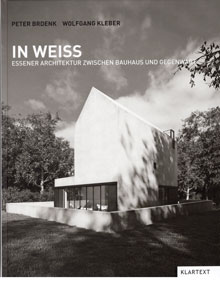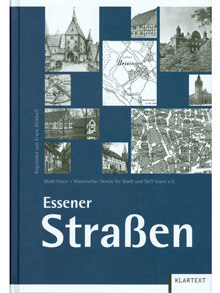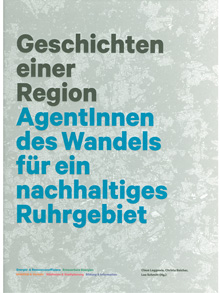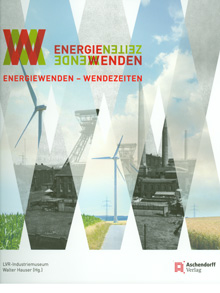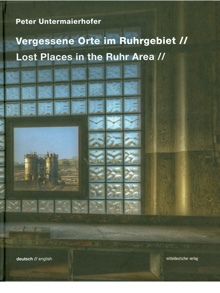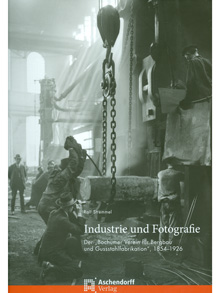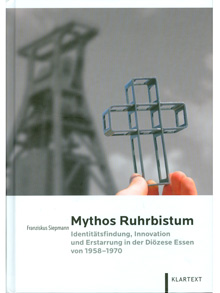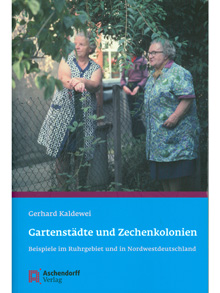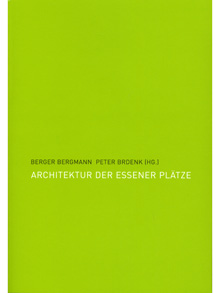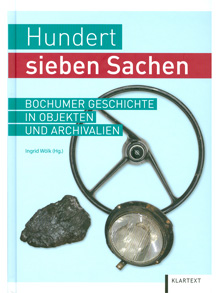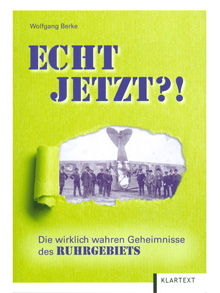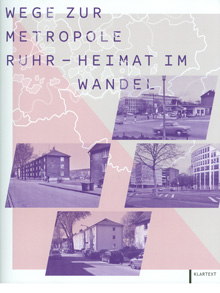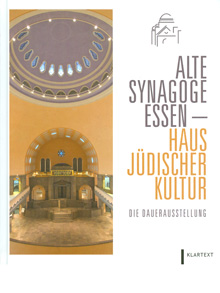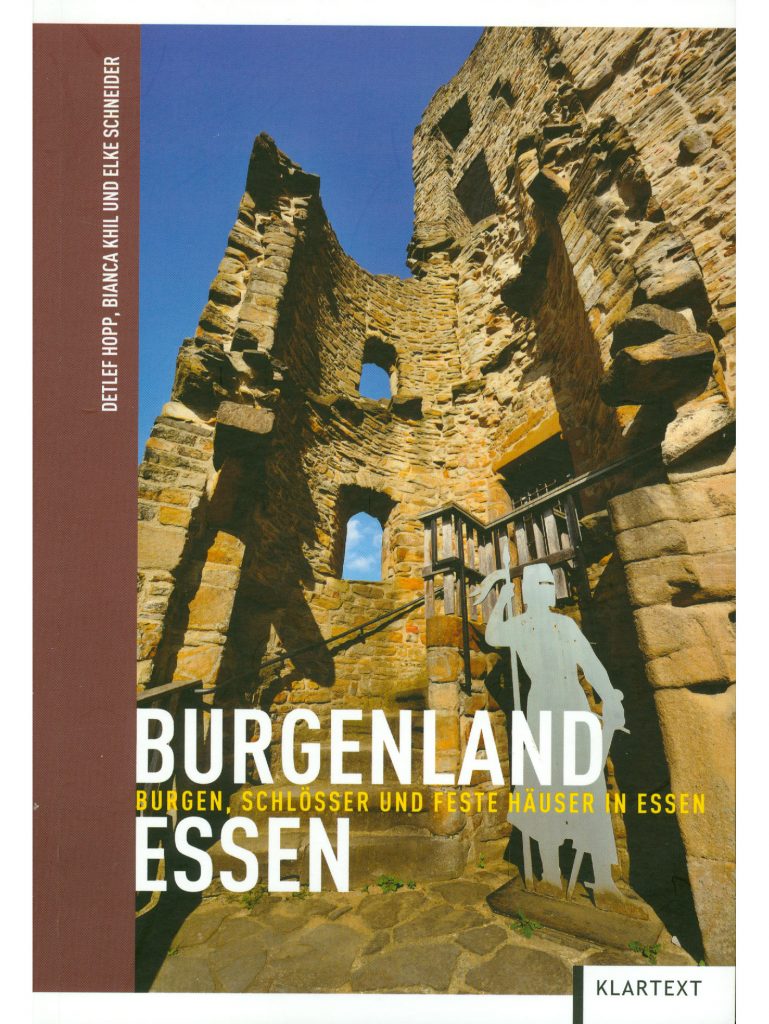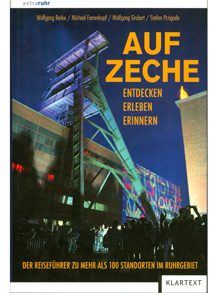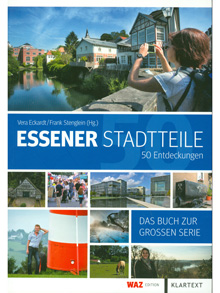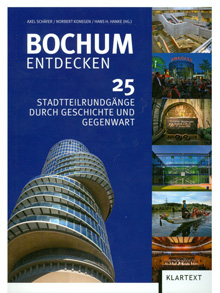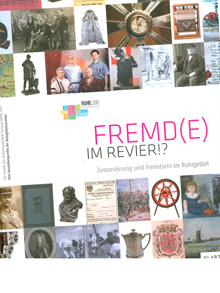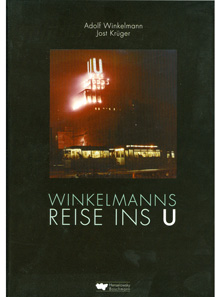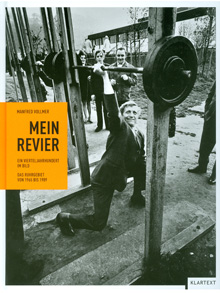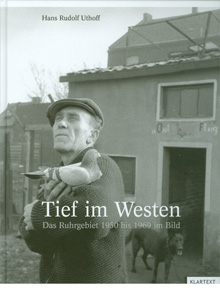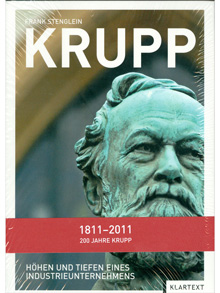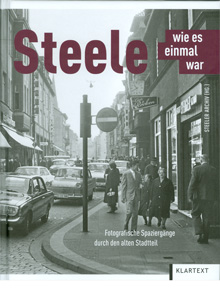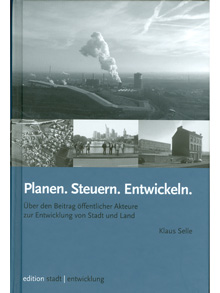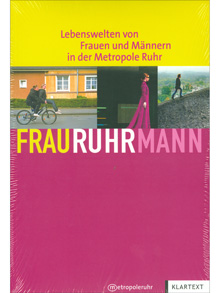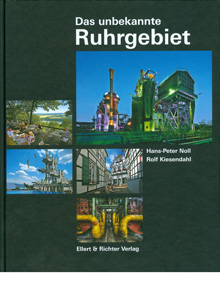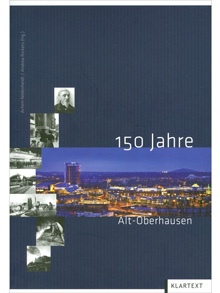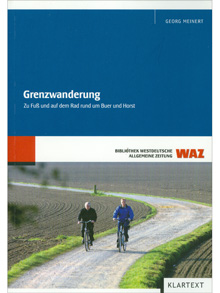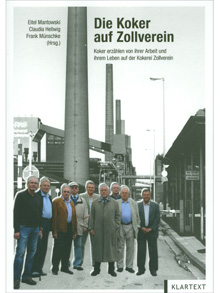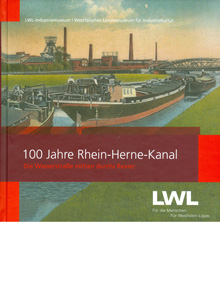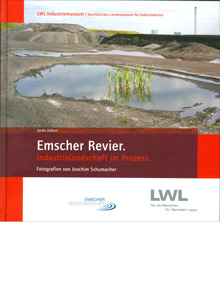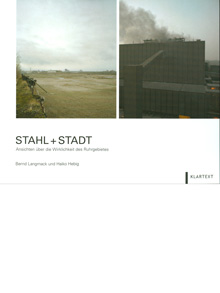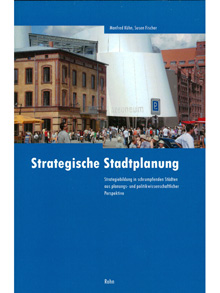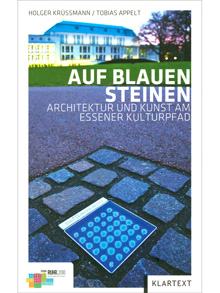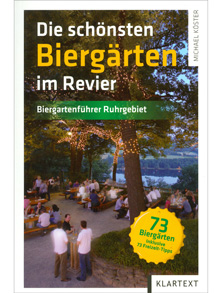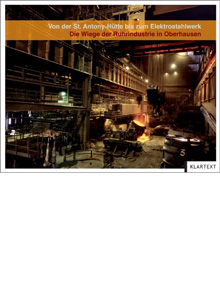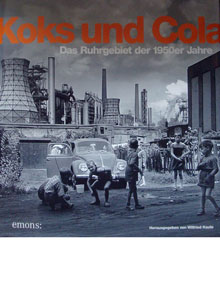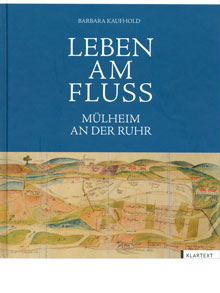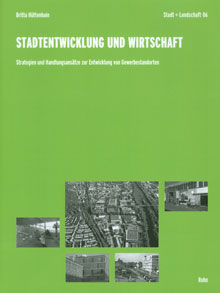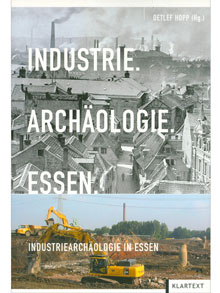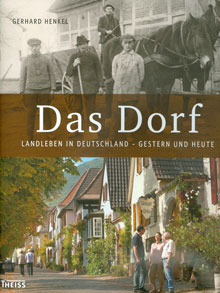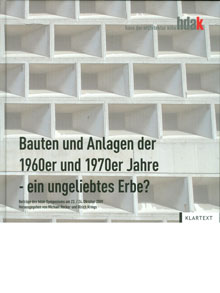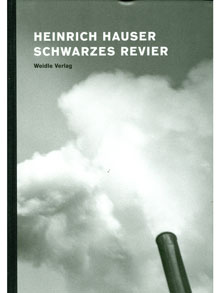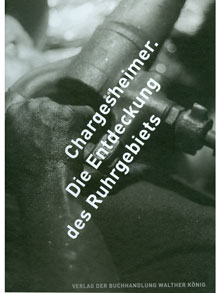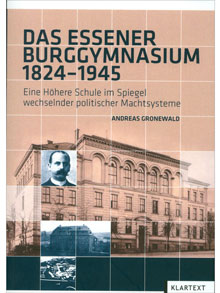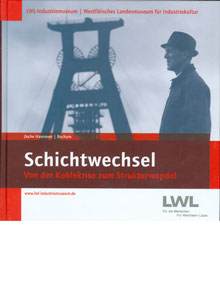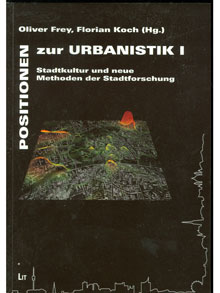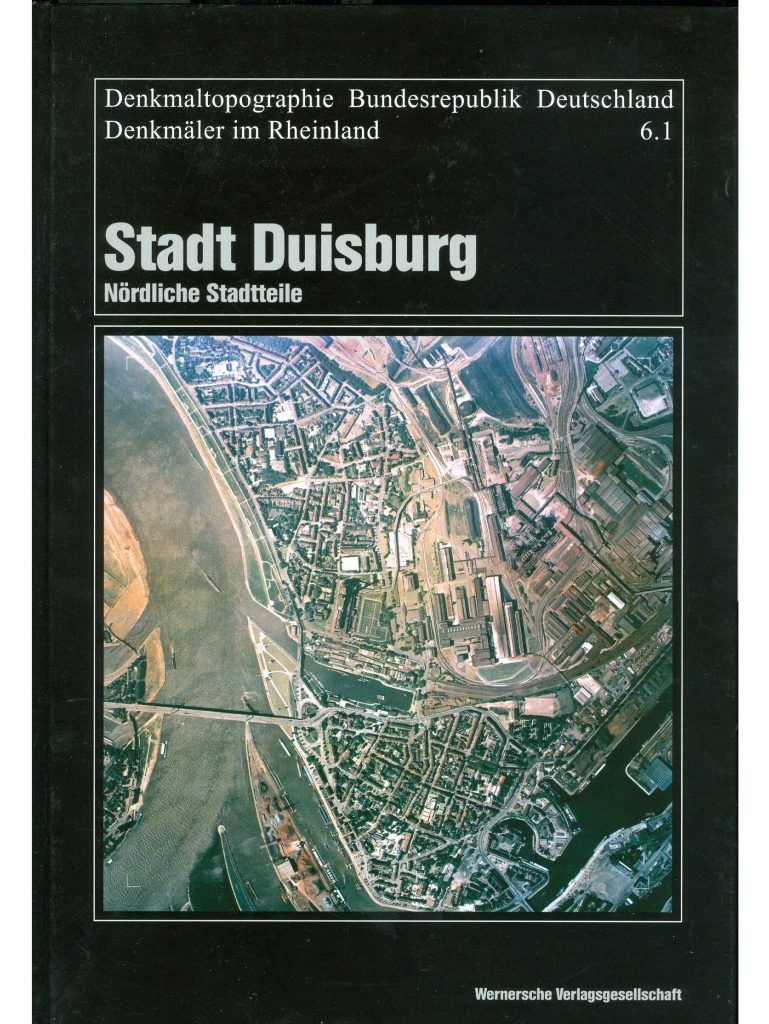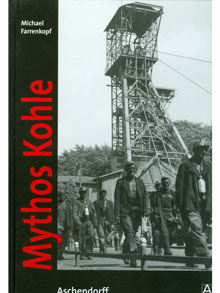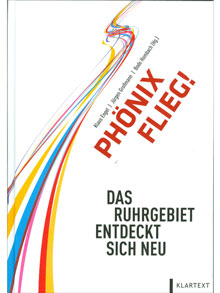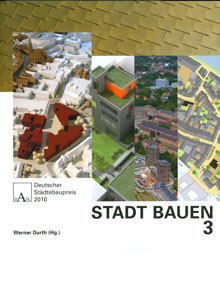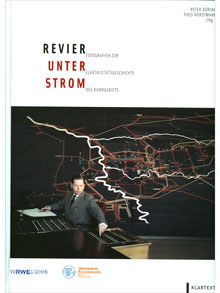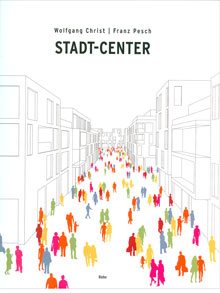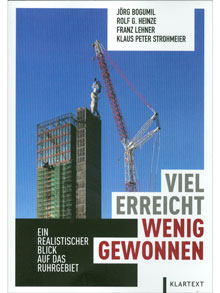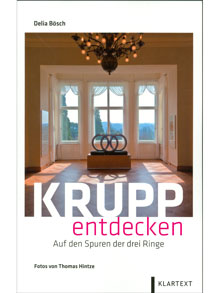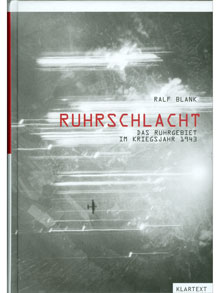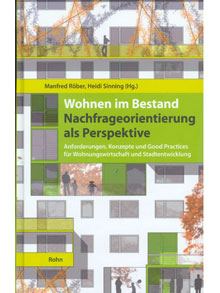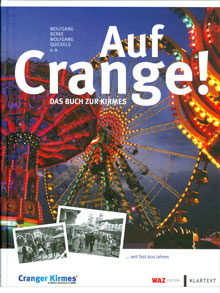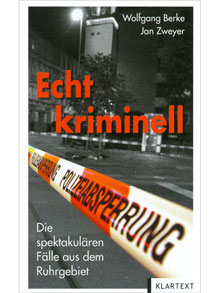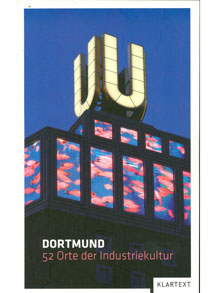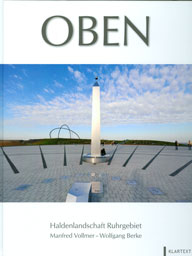Bücherecke mit Rezensionen von Prof. H.-W. Wehling
- Alle
- Bücherecke 2019
- Bücherecke 2021
- Bücherecke 2022
- Bücherecke 2023
- Weitere Publikationen
EmscherSkizzen. Menschen und Orte im neuen Emscherland
Christoph Hübner/Gabriele Voss, 66 Kurzfilme (2006-2015). DVDs, Essen (Klartext) 2022, € 14,95
Streaming-Dienste fordern nicht selten zu Serienmarathons auf. Hier haben Sie die Möglichkeit. Die filmische Arbeit von zehn Jahren hat in 66 Kurzfilmen mit zusammen fast zehn Stunden ein Porträt dieser abwechslungsreichen Landschaft hervorgebracht. Entsprechend abwechslungsreich sind die Filmthemen und ihre stilistische Umsetzung die Szenerien sind mit Geduld beobachtet; Landschaften und Orte werden nicht zu kurzen Impressionen zerschnitten, nicht selten überwiegen die langen Einstellungen. Die filmischen Eindrücke werden von den Autoren nicht kommentiert. Zu Wort kommen allerdings Spaziergänger und Rentner, alteingesessene Bauern und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Künstler mit neuen Perspektiven, insgesamt Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken machen, was da für eine veränderte Welt vor ihren Augen entsteht. Lehnen Sie sich zurück und lassen sie die Emscherlandschaft von der Quelle bis zur Mündung an sich vorbeiziehen.
Die Emscher. Bildgeschichte eines Flusses – Beyond Emscher. Fotografische Positionen aus der Gegenwart – Emscher 2021+. Die neue Emscher kommt – Sozial-ökologischer Umbau einer regionalen Stadtlandschaft
Heinrich Theodor Grütter/Uli Paetzel (Hg.), Die Emscher. Bildgeschichte eines Flusses. Essen (Klartext) 2022, 288 S., ISBN 9783837525311, € 29,95
Heinrich Theodor Grütter/Uli Paetzel (Hg.), Beyond Emscher. Fotografische Positionen aus der Gegenwart. Köln (Wienand) 2022, 303 S., ISBN 9783868327069, € 29,80
Uli Paetzel/Dieter Nellen/Stefan Siedentop (Hg.), Emscher 2021+. Die neue Emscher kommt – Sozial-ökologischer Umbau einer regionalen Stadtlandschaft. Berlin (jovis) 2022, 327 S., ISBN 9783868597486, € 55,00
Vor allem die Ausstellungen im Ruhrmuseum und ihr Begleitprogramm zur Emscher, ihrer Entwicklung und ihrer fast zum Abschluss gebrachten Umgestaltung haben eine Reihe von interessanten Veröffentlichungen hervorgebracht.
Da ist zunächst der Ausstellungskatalog „Bildgeschichte eines Flusses“, der in sieben Kapiteln die Entwicklung der Emscher vom vorindustriellen mäandrierenden Flachlandfluss (Die alte Emscher) über den Industriefluss bis zum postindustriellen, landschaftlich gestalteten oberirdischen Teil eines technisch einmaligen regionalen „Wasserbauwerks“ darstellt. Gemälde, technische Zeichnungen, Landkarten sowie eine Fülle von Fotos, die die historische und aktuelle technische Entwicklung, die Bedeutung des Wassers in der Emscherniederung, technische Bauwerke und Lebensverhältnisse entlang des Flusses dokumentieren, machen den Reiz dieses Buchs aus. Aus geographisch-kartographischer Sicht ist hervorzuheben, dass in diesem Band die interessanten und selten publizierten historischen Karten besondere Fürsorge erfuhren und sie nicht, wie so häufig, aus „Platzgründen“ bis zur Unleserlichkeit miniaturisiert oder gar durch den Bund gezogen wurden. Wer den zweimaligen Wandel dieses Raums nachvollziehen will, dem sei dieser Band uneingeschränkt empfohlen.
Das Gebiet beiderseits der Emscher ist nicht nur seit über 100 Jahren ein regionales Entwässerungsgebiet, sondern seit den Hochzeiten der industriellen Entwicklung Arbeits- und Lebensraum; besondere, teilweise unvollkommene städtische Strukturen mit eigener optischer Faszination sind sein Charakteristikum. Hier setzt der zweite Ausstellungskatalog „Beyond Emscher“ an und präsentiert aus dem Projekt „emscherbilder“ die sehr unterschiedlichen Sichtweisen von 17 Fotograf*innen auf diesen Raum aus den Jahren 2016 bis 2022; insgesamt geht es um folgende Themen: Verschiedene Uferansichten – Innenansichten des Hauses D, Phoenix See – Bewohner des Lebensraums rund um den Phoenix-See – „Insellagen“ vom Emscherdelta bis zur Emscherquelle – Drei Höfe – Freiheit Emscher (Blicke auf die Brache) – Häfen im nördlichen Ruhrgebiet – Chongqing Express (Die neue Seidenstraße) – Wanderarbeiter am Klärwerk Dinslaken (und ihre polnische Heimat) – 13 Porträts/13 Geschichten (Bewohner des Lebensraums entlang der Emscher)– Feldforschung-Herbarium – Zwischen zwei Strömungen (Emscher und Rhein-Herne-Kanal) – Besucherin (Wohnverhältnisse) – Naherholung und Ökologie am Rückhaltebecken in Ickern und Mengede – ohne Titel (Porträts). Allen Fotostrecken sind Konzeptbeschreibungen der Fotograf*innen beigegeben, die ihre Intentionen erläutern. Erwartungsgemäß präsentieren diese Fotos den Raum
Das Moltkeviertel in Essen. Die etwas andere Gartenstadt
Berger Bergmann/Peter Brdenk (Hg.), Essen (Klartext) 2022, 84 Seiten, ISBN 9783837525601, € 14,95
Die vorliegende Veröffentlichung ist ein weiterer Band in der von den Herausgebern betreuten Reihe „Architektur in Essen“ und kann sich – wie in der Einführung festgestellt wird – auf eine breite Basis vorhandener Literatur stützen. Daher erscheint die Zielsetzung des Buches etwas bemüht. So soll vor allem ein städtebaulicher Bezugspunkt gesetzt und die Straßennamen gebenden Architekten des Viertels in ihrer (zukunftsweisenden) Bedeutung für den deutschen und internationalen Städtebau herausgestellt werden. Für diese ergänzende Sichtweise wird einer Gruppe junger Kunsthistorikerinnen eine Publikationsplattform geboten; dies als „generationsübergreifende“ Umsetzung zu adressieren, erscheint jedoch ein wenig überzogen.
Die Veröffentlichung beginnt mit einer räumlichen und historischen Einordnung des Viertels in die Essener Stadtentwicklung, dies mit Bezügen zu Robert Schmidt, der Gartenstadt-Idee, dem Verhältnis von Gestaltung und Topographie sowie den getroffenen planerischen Festlegungen. Das nächste Kapitel schlägt einen Bogen von einer Betrachtung der verschiedenen Bauphasen mit ihren Stilentwicklungen/-änderungen, über die Betrachtung von Einzelbauten und der Kunst im Moltkeviertel bis hin zu einer Erwähnung berühmter Bewohner des Moltkeviertels. Es folgt die eingangs erwähnte biographische Behandlung der namensgebenden Architekten sowie eine etwas stiefmütterliche der Architekten, die das Moltkeviertel eigentlich gestaltet haben. Der Band schließt ab mit den üblichen Verzeichnissen und einer Aufzählung der Vereine des bürgerlichen Engagements im Moltkeviertel.
Dieses einmal wieder der Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen scheint das wesentliche Motiv für diese Veröffentlichung gewesen zu sein. Da die meisten Fakten bekannt sind, ist der Erkenntnisgewinn gering und die biographischen Darstellungen der namensgebenden Architekten kommen über seminaristische Fleißarbeiten nicht hinaus.
Geofaktor Mensch
Soeben erschienen ist das neue Buch "GEOFAKTOR MENSCH" unseres Beiratsmitglieds DR. DIETHARD E. MEYER.
Verlag Springer Nature- Springer Spektrum
Hardcover (ISBN 978-3-662-63849-1)
eBook-Fassung (ISBN 978-3-662-63851-4)
Das Werk bietet allgemein verständlich ein breites Spektrum über Umwelteingriffe und deren Folgen auf den Festländern, im Meer und in der Atmosphäre und zeigt die Folgen für Mensch, Tier- und Pflanzenwelt. Es enthält ca. 95 Abbidlungen und zahlreiche Tabellen und Übersichten.
Das Ruhrgebiet im Ersten Weltkrieg. Technik und Wirtschaft.
Das Ruhrgebiet im Ersten Weltkrieg. Technik und Wirtschaft.
Manfred Rasch: Das Ruhrgebiet im Ersten Weltkrieg. Technik und Wirtschaft. Münster (Aschendorff) 2022, 553 S., zahlreiche Abbildungen, ISBN 978-3-402-13334-7
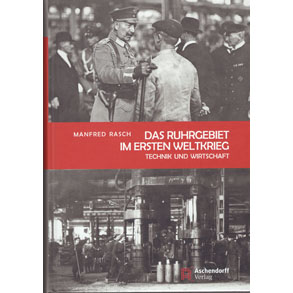
Wenngleich der Autor in seinem Resümee am Ende des Buches noch zahlreiche Desiderate im Hinblick auf das Thema des Ersten Weltkriegs und der Entwicklung und des Verhältnisses von Technik und Wirtschaft konstatiert und seine vorliegende Veröffentlichung als überblickshafte regionale Studie mit technikgeschichtlichen Fragen bezeichnet, so bedeutet „überblickshaft“ hier nicht „oberflächlich“, sondern der Autor erschließt hier in großer thematischer Breite eine wirtschaftsgeschichtlich wichtige Periode in der Ruhrgebietsentwicklung. Die 23 Kapitel folgen einer überzeugenden Sachlogik. Nach der Darstellung der wirtschaftlichen Sofortmaßnahmen nach Kriegsbeginn werden die Produktion von Sprengstoffvorprodukten, die Gewinnung flüssiger Treib- und Schmierstoffe, die Munitionserzeugung und Geschützproduktion, die Marine- und Luftrüstung sowie die Herstellung sonstiger Kriegsprodukte analysiert. Es folgen Kapitel über die Eisenbahnentwicklung sowie über die Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelversorgung. Zivile und militärische Bautätigkeit sowie Instandhaltungsmaßnahmen infolge Kriegszerstörungen bilden den nächsten Schwerpunkt. Das Hindenburgprogramm zur Förderung der Kriegsproduktion entfaltete im Ruhrgebiet eine große transformatorische Kraft, erzeugte jedoch auch technische Probleme. Es erforderte die Entwicklung einer Reihe von Ersatzstoffen und war angesichts des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels nur durch den Einsatz von Frauen und die Zwangsrekrutierung von Zwangsarbeitern und Strafgefangenen zu erfüllen. Die Berliner Politik nahm zunehmenden Einfluss auf die Gestaltung der regionalen Wirtschaft, die „Waffenschmiede“ wird geboren und übt eine hohe Attraktion auf verschiedene Politiker- und Interessengruppen auf. Ergebnisse der Kriegswirtschaft waren zum einen erhebliche Kriegsgewinne der Unternehmen, zum anderen deren Konzentrationstendenzen. Das Kriegsende brachte grundlegende politische Veränderungen auf nationaler und regionaler Ebene mit sich, denen zeitweilige wirtschaftliche Abbrüche folgten, die wiederum wirtschaftliche Neuausrichtungen notwendig machten und neue Interessensgemeinschaften entstehen ließen. Dennoch wurden in den gut fünf Jahren, die dieses Buch zeitlich umfasst, auch nachhaltige Wirtschaftsstrukturen aufgebaut und innovative technische Entwicklungen auf den Weg gebracht, die dazu beitrugen, dass das Ruhrgebiet etwa 1936/37 seinen organisatorisch-technischen Höhepunkt erreichten konnte, bevor es – wenngleich mit anderen inneren Strukturen wieder zur „Waffenschmiede“ des deutschen Reichs wurde. Dieses Buch von Manfred Rasch ist faktenreich, vielschichtig und inspirierend. Indem es „überblickshaft“ ist, zeigt es an vielen Stellen auf, wo es sich lohnt, andere Quellen zu erschließen oder weitergehende Forschungen zu betreiben.
Zur Entstehung der deutschen Stadt vom Reichsdeputationshauptschluss (1803) bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.
Zur Entstehung der deutschen Stadt vom Reichsdeputationshauptschluss (1803) bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.
Carsten Jonas, Berlin (Wasmuth & Zohlen) 2021, 244 S., zahlreiche Abbildungen, ISBN 978-3-8030-2103-8
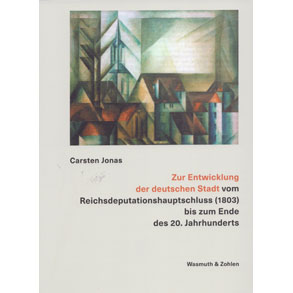
Die vorliegende Veröffentlichung ist die Druckfassung mehrerer Vorlesungen des Verfassers. Für die Zeit seit Beginn des 19. Jahrhunderts werden die Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung skizziert und die städtebaulichen Strömungen und Zielsetzungen präsentiert. In den meisten Fällen werden sie durch prägnante Beispiele erläutert. Das Buch bietet programmatisch nichts Neues, sondern alle Erkenntnisse sind aus vorliegenden Büchern zur Stadtgeographie und zur Entwicklung des Städtebaus in Deutschland hinlänglich bekannt. Dem Buch ist eine Vielzahl in ihrem Erklärungspotential bereits in den vorhandenen Büchern erprobter Abbildungen beigegeben; die Mehrzahl von Ihnen ist jedoch stark, manchmal bis zur Unleserlichkeit miniaturisiert worden, wodurch der Lehrbuchcharakter des Buches deutlich geschmälert wird.
Geschichte(n) des Bistums Essen in 30 Objekten.
Geschichte(n) des Bistums Essen in 30 Objekten.
Florian Bock, Sebastian Eck, Miriam Niekämper, Lea Torwesten (Hg.). Münster (Aschendorff) 2021, 196 S., zahlreiche Abbildungen, ISBN 978-3-402-24774-7
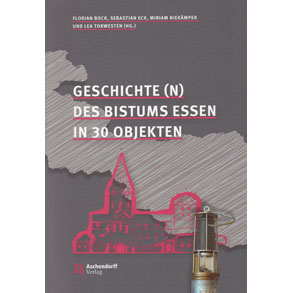
Seit dem Bestseller „A History of the World in 100 Objects“, das Neil MacGregor, seinerzeit Direktor des British Museums, 2010 herausbrachte, erzählen Museologen Geschichte gerne durch die Präsentation einzelner, manchmal scheinbar banaler Ausstellungsstücke. Mittels 30 ausgewählter aussagekräftiger Exponate (Bauten, Skulpturen, Gegenstände) an unterschiedlichen Standorten im Gebiet des Bistums Essen werden deren und dessen Geschichte(n) erzählt. Zeitlich sind die Objekte in die Zeit seit der Bistumsgründung) im Jahre 1958 einzuordnen, weisen jedoch inhaltlich z.T. weit in die Vergangenheit zurück. Die Darstellung eröffnet die Spendentüte von 1959, die für Zuwendungen zum Bau des Priesterseminars in Essen-Werden bestimmt war, und endet mit der Christkönigverehrung in Kirchenbau und Liturgie und mit der Neunutzung der Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen-Ückendorf als Multifunktionshaus. Dazwischen gibt es den Konzilssitz S585 von Bischof Hengsbach aus dem Jahr 1965, den Wohnwagen, den das Bistum zur Touristenseelsorge ab 1967 in die Dünen von de Koog auf der holländischen Insel Texel stellte, den Souvenir-Lolli vom Papstbesuch 1987, das Dialogkreuz von 2013 als Symbol für den im Bistum eingeleiteten pastoralen Weg bis zum Pannini-Sammelbild der Goldenen Madonna von 2015. Die 30 Objekte spiegeln die räumliche, zeitliche und thematische Vielfalt im Bistum Essen wieder, bieten aber auch manch vordergründig Überraschendes.
Die Ruhr und ihr Gebiet. Leben am und mit dem Fluss.
Die Ruhr und ihr Gebiet. Leben am und mit dem Fluss.
Bodo Hombach (Hg.), ISBN 978-3-402-24640-5, €39,90
Dieses auf zwei Bände und 800 Seiten ausgedehnte Buch ist ein „inhaltlich beschränktes“, weil bewusst rückbesinnendes. Darstellungen der Entwicklung des Ruhrgebiets beginnen immer an der Ruhr, im Sog der industriellen Expansion verlassen sie das Ruhrtal meist schon um 1860 und wenden sich den „dynamischeren“ Bereichen beiderseits der Emscher zu. Das rheinisch-westfälische Industriegebiet mutierte in den 1920er/1903er Jahren zum Ruhrgebiet – zu einem Zeitpunkt, als der Produktionsschwerpunkt längst weiter nach Norden gewandert war und die Bereiche beiderseits der Ruhr strukturell längst nicht mehr repräsentativ für diese Industrieregion waren. Dieses Buch folgt nur gelegentlich dem vorgezeichneten Trend, sondern bleibt an der Ruhr – von der vorindustriellen Zeit bis in die Gegenwart und in einer großen inhaltlichen Breite.
Der Band (Heimat Ruhr: Fluss, Tal, Siedlung seit Anfang des 19. Jahrhunderts) widmet sich dem „Naturraum Ruhr“, dem „Naturwirtschaftsraum Ruhr“, mit dem die Landwirtschaft, der Weinbau, das Fischereiwesen …. gemeint ist, dem „Wohnraum Ruhr“ (Leben am Fluss, Stadtplanung, Wohnverhältnisse …) und dem „Kulturraum Ruhr“ (Kunstobjekte, Museum, Industriekultur, Ruhrliteratur …). Der Band (Fluss, Industrieregion, Strukturwandel seit Anfang des 19. Jahrhunderts) geht zunächst unter dem Titel „Wirtschaftsraum Ruhr“ der Bedeutung der Ruhr innerhalb der regionalen Industrialisierung nach, der „Verkehrsraum Ruhr“ behandelt die Ruhrschifffahrt und die Eisenbahnen im Ruhrtal mit allen Wandlungen bis in die Gegenwart, der „Wasserwirtschaftsraum Ruhr“ die Bedeutung der Ruhr als regionaler Wasserversorger. Unstrittig ist heute der Freizeitwert von Ruhr und Ruhrtal. Dementsprechend behandelt der „Sport- und Freizeitraum Ruhr“ die ungeplante Freizeitnutzung, das organisierte Baden, den Wassersport, den Angelsport, das Wandern auf den Ruhrhöhen und nicht zuletzt das Kaffeetrinken in einem der zahlreichen Restaurants mit Blick auf die Ruhr. Insgesamt präsentieren die beiden Bände eine mit bekannten, mehrheitlich jedoch unbekannten Abbildungen gut ausgestattete Vielzahl von Blickwinkeln auf die Ruhr, dank einer guten Editierung sind Wiederholungen selten. Die Brost-Stiftung hat sicherlich dazu beigetragen, dieses attraktive Werk auch zu einem attraktiven Preis zu ermöglichen.
Vom Ruhrgebiet zur Metropole Ruhr, SVR KVR RVR 1920-2020
Vom Ruhrgebiet zur Metropole Ruhr, SVR KVR RVR 1920-2020
Karola Geiß-Netthöfel, Dieter Nellen, Wolfgang Sonne (Hg.), Berlin 2020, ISBN 978-3-86859-584-0, €45,00
Das hundertjährige Bestehen von SVR/KVR/RVR ist Anlass für dieses mit schwerem Papier und Silberschnitt haptisch und optisch designte großformatige coffee-table book; es ist ein Buch der Selbstdarstellung – des Verbandes und der Region. Ausgesucht schöne Bilder begleiten die Kurzdarstellungen von RVR-Mitarbeitern in den Großkapiteln zur „Geschichte und Gegenwart“ des Verbandes, zur „Leitstrategie und Programmagenda“ des RVR 20/21+ und zum Thema „Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“. Sechs essayistische Betrachtungen externer Beobachter runden den Band ab – Claus Leggewie zur Wunschvorstellung Metropole Ruhr, Wolfgang Sonne zu 100 Jahren Ruhrstädtebau, Stefan Siedentop zur Transformation einer verspäteten Region, Stefan Leiner zur grünen Infrastruktur, Dieter Nellen zur IBA und ihren Nachwirkungen und Christoph Zöpel zur postmontanindustriellen Kulturlandschaft Ruhr. Dem regional Kundigen bietet dieses Buch keine neuen Erkenntnisse; das war jedoch auch nicht seine Absicht. Es ist vielmehr aus gegebenem Anlass ein in Text und Bild gut informierender und durch ein klares Bild-Text-Konzept attraktiver Jubiläumsband für eine interessierte Öffentlichkeit.
Aus rein geographischer Sicht ist schließlich noch positiv anzumerken, dass gute kartographische Darstellungen des RVR einmal nicht bis zur Unleserlichkeit miniaturisiert wurden, sondern ihnen mit Klappkarten ein verdienter Stellenwert gegeben wurde.
Kohle, Koks und Kolonie. Das Verbundbergwerk Gneisenau in Dortmund-Derne
Kohle, Koks und Kolonie. Das Verbundbergwerk Gneisenau in Dortmund-Derne
Gabriele Unverferth, Münster 2020, ISBN 978-3-402-24641-2, €49,90
Zu den „Schätzen“ in der regionalen Bergbauliteratur gehören die Darstellungen der Schachtanlagen der Vereinigten Stahlwerke aus den 1930er Jahren. An diese Tradition knüpft die Verfasserin ausdrücklich an, geht aber mit Hilfe ehemaliger leitender Mitarbeiter des Verbundbergwerks sowie der Fachleute aus den verschiedenen Förder- und Geschichtskreisen um die Zeche Gneisenau deutlich darüber hinaus, indem die Entwicklung der Zeche Gneisenau in die Geschichte des Ruhrbergbaus im Allgemeinen und der Harpener Bergbau-AG im Besonderen eingebunden wird. Entstanden ist so ein Werk, das auf über 400 Seiten und ausgestattet mit über 600 Abbildungen in tiefer Gliederung von der Darstellung der Berechtsame, der Besitzverhältnisse und der geologischen Verhältnisse ausgehend sich zunächst der Entwicklung der Schachtanlagen Gneisenau bis 1945 zuwendet. Es folgen die Entwicklungen im Bergwerksbetrieb, die Arbeits- und Versorgungsverhältnisse der Bergarbeiter einschließlich des Wohnungsbaus und des Vereinswesens, die Darstellung der Entwicklung vom Wiederaufbau bis zur Stilllegung sowie der vielfältigen Neunutzungen auf dem Gelände. Der Anhang umfasst Zeittafeln, mehrere Lagepläne, Baufelderkarten und Schachtschnitte, Statistiken über Förderung, Kokserzeugung und Belegschaft, die Erläuterung bergbaulicher Fachbegriffe sowie das Literatur- und Quellenverzeichnis. Das Verbundwerk Gneisenau war ein großes und leistungsfähiges Bergwerk, das fast ein Jahrhundert sein räumliches Umfeld geprägt und das Leben von Generationen von Bergleuten und ihren Familien bestimmt hat. Dieses empfehlenswerte Buch ist in hohem Maße geeignet, die Erinnerung an dieses Bergwerk aufrecht zu erhalten.
Gute Karten. Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben.
Gute Karten. Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben.
Tin Fischer. Hamburg 2020, ISBN 978-3-455-00882-1, €25,00
Bücher wie diese, hat es schon häufiger gegeben. Es geht nur in einigen Fällen um Karten im engeren Sinne, die meisten gebotenen Darstellungen sind Kartogramme. Es gibt einfache Verteilungskarten (der Ortsnamensendungen oder idiomatischer Ausdrücke, der Kartoffel- oder Weintraubenproduktion oder der Tennisplätze und Swimmingpools), kartenbezogene Darstellungen „unnützen“ Wissens (die Sprachgrenze von „schiena“ und „kina“ für China; in Sachsen-Anhalt werden am meisten Sexstellungen gegoogelt; die Höhe des Hermannsdenkmals im Vergleich zu anderen Denkmälern weltweit), bekannte Kartenverformungen wie die Sicht der Münchner auf Deutschland, sinnfreie Größenvergleiche zwischen der Größe des Spaßbades Tropical Islands in Brandenburg und dem Vatikan oder der Mitgliederzahl der katholischen Kirche und des ADAC. Es gibt aber durchaus witzig-interessante und wissenschaftlich interessante Fragestellungen (Wo liegt Schwaben; Größenvergleich zwischen Deutschland und ähnlich großen Ländern weltweit; ungleiche Verteilungen der Menschen, Schweine und Kühe in Deutschland; bevorzugte Zielgebiete deutscher Auswanderer; regionale Spezialitäten; Laufentfernung zu Basiseinrichtungen wie Apotheke, Grundschule, Bushaltestelle oder Supermarkt; die Unterrepräsentanz Deutschlands in Google Street View im europäischen Vergleich; die Drogenbelastung der Abwässer). Das Kartendesign ist ansprechend, mäßig generalisierend und farblich wohltuend zurückgenommen. In etlichen Fällen hätte man sich aber mehr Text gewünscht, einerseits dann, wenn es der Kartographie nicht ganz gelingt, die Aussage zu transportieren, und anderseits, wenn sie genau dies tut und weitere Fragen aufwirft.
Unruhige Zeiten. Politische und soziale Unruhen im Raum Essen 1916-1010.
Unruhige Zeiten. Politische und soziale Unruhen im Raum Essen 1916-1010.
Klaus Wisotzky, Münster 2019, ISBN 978-3-402-14209-7, €29,90
Das Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv hat eine neue Veröffentlichungsreihe begründet und eröffnet sie mit dieser wichtigen Arbeit ihres ehemaligen Leiters.
Verelendung, Tod und Gewalt, politische und wirtschaftlich Umbrüche, soziale Unruhen und Streiks machten die letzten Jahre des Ersten Weltkriegs und das Revolutionsjahr zu unruhigen Zeiten. In 14 Kapiteln unterschiedlicher Länge bricht Klaus Wisotzky diese nationalen Verhältnisse und Prozesse auf die lokale Ebene der Stadt Essen herunter. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Streikaktionen während des Krieges, der Tätigkeit des Arbeiter- und Soldatenrates, den Parteien und der Wahl von 1919, auf der Umstellung von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft und ihren teilweise durchgreifenden Auswirkungen, auf der Bergarbeiterbewegung von 1916 bis 1919 und auf dem Generalstreik von 1919. In einem Schlusskapitel gibt Wisotzky eine vergleichende Bewertung und Einordnung der Ereignisse. Detailreich und auf einer breiten Quellenbasis geschrieben ist dieses Buch ein würdiger Beginn der neuen Veröffentlichungsreihe.
Weiter bauen. Werkzeuge für die Zeitschichten der Stadt.
Weiter bauen. Werkzeuge für die Zeitschichten der Stadt.
Alexandra Apfelbaum, Yasemin Utku, Christa Reicher, Gudrun Escher, Magdalena Leyser-Droste, Beiträge zur städtebaulichen Denkmalpflege, Band 9, Essen 2019, ISBN 978-3-3875-2111-5, €24,95
Städtebauliche Entwicklung setzt auf städtebaulichem Bestand auf; damit hat Denkmalschutz nicht nur eine bewahrende Funktion, sondern beeinflusst auch die zukünftige Entwicklung, vermag ihr in Maßen sogar eine Perspektive zu geben. Unter diesem Gedanken stand die Jahrestagung 2017 der Dortmunder Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege, deren Beiträge in diesem Band unter den Überschriften „Zeitschichten erfassen“, „Werkzeuge erproben“ und „Historie weiterbauen“ zusammengestellt wurden. Zu den dabei vorgestellten regionalen Beispielen gehören in Münster die Speicherstadt Coerde und die Bebauung des Geländes der ehemaligen York-Kaserne, die Reflektion über die Ruhrmoderne in Marl, Formen des „Brutalismus“ in Köln und die Stadterneuerung entlang der Bochumer Straße in Gelsenkirchen
Stadtbaukultur NRW: Architektur der 1950er bis 1970er Jahre im Ruhrgebiet/ Architecture of the 1950s to 1970s in the Ruhr Area.
Stadtbaukultur NRW: Architektur der 1950er bis 1970er Jahre im Ruhrgebiet/ Architecture of the 1950s to 1970s in the Ruhr Area.
Tim Rieniets, Christine Kämmerer, Dortmund 2018, ISBN 978-3-86206-755-8, €25,00
Der in diesem Buch betrachtete Zeit war in der Stadtentwicklung des Ruhrgebiets zweigeteilt, umfasst er doch zunächst den wirtschaftlichen und städtebaulichen Aufbruch der Nachkriegszeit, in der manche Industriestadt sich mit innovativer/avangardistischer Stadtarchitektur neu zu definieren suchte, zum anderen gehört dazu der Zeitraum, in dem – zum Teil in einem living lab – städtebauliche Dominanten entstanden, die die funktionalen Defizite überwinden helfen sollten. So versammelt dieser Band, thematisch gegliedert, in englischer und deutscher Sprache Würdigungen von 53 herausragenden Bauten und Anlagen im Ruhrgebiet aus diesen zwei Jahrzehnten, z.B. die Neue Stadt Wulfen, den Wohnhügel von Marl, das Schauspielhaus in Bochum und das Musiktheater in Gelsenkirchen, das Karstadt-Gebäude in Herne, die Karstadt-Hauptverwaltung in Essen, die Heilig-Geist-Kirche in Essen oder die Heilig-Kreuz-Kirche in Bottrop. Ein insgesamt in Text und Bebilderung informatives Buch, da sich auch gut als Grundlage für eine entsprechende Entdeckungstour eignet; zu bemängeln ist lediglich der recht hohe Preis.
Versemmelt. Das Ruhrgebiet ist am Ende.
Versemmelt. Das Ruhrgebiet ist am Ende.
Stefan Laurin, Bottrop 2019, ISBN978-3-942094-98-6, €9,90
Dieses Buch präsentiert die bekannten Geschichten vom Ruhrgebiet und seiner Entwicklung, von der Gründung des innovativen Siedlungsverbandes, von seinem umwälzenden Strukturwandel, von seinem Image und den Bemühungen es zu verändern – aber nicht in der akzeptierten Mainstream-Version. Der Autor kommt zu ähnlichen Befunden wie 2017 Bogumil, Heinze, Lehner und Strohmeier in „Viel erreicht – wenig gewonnen“; aber wo damals die Haltung der Autoren professoral-distanziert „realistisch“ war, ist Stefan Laurin – manchmal mit einer resignierenden Müdigkeit – bitter-böse subjektivin seinen Erkenntnissen: das Ruhrgebiet war immer eine Goldgräberregion, die durch ihren wirtschaftlichen Verfall weder mental noch kulturell zu einer Metropole wird; der Strukturwandel milderte den Arbeitsplatzverluste, war aber nicht nur finanziell, sondern auch hinsichtlich der Ideen von außen gesteuert; die Abhängigkeit von, zunehmend jedoch das permanente Schielen nach Fördermitteln erstickte fast jede Eigeninitiative; der einst innovative Thinktank SVR/KVR/RVR ließ sich zunehmend entmachten, nicht zuletzt wegen der Unfähigkeit seines Spitzenpersonals in den letzten Jahrzehnten; die (notgedrungen) selbst betriebene Kooperation der Städte wird ihn weiter der Bedeutungslosigkeit zuführen; große Initiativen wie die IBA und die Kulturhauptstadt sind durch den regionalen Dilettantismus verpufft; die Gründung eines notwendigen Regierungsbezirks Ruhrgebiet scheitert an inneren und äußeren diffundierenden Kräften; das Ruhrgebiet scheint mittlerweile zum Gegenentwurf der zumindest teilweise blühenden Landschaften in den neuen Bundesländern geworden zu sein. Insgesamt ist das empfehlenswerte Buch keine Mainstream-Darstellung, es werden aber auch keine „alternativen Fakten“ präsentiert, sondern nur eine andere – engagierte – Sichtweise, die möglicherweise die wahrere ist.
Ein Traum in bunt. Entdeckung Ruhrgebiet.
Stefan Thoben (2021): Ein Traum in bunt. Entdeckung Ruhrgebiet. Verlag Andreas Reiffer, Meine, 238 S., ISBN 97839455715734, € 28,00
Das Image des Ruhrgebiets ist von Beginn an von Ansichten und Sichtweisen von außen beeinflusst worden. Levin Schücking bewunderte die Schnelligkeit und Neuartigkeit der industriellen Entwicklung, Joseph Roth war fasziniert und irritiert zugleich von der Unordnung und Hässlichkeit der dabei entstehenden Industrielandschaft, Heinrich Böll war besoffen vom Arbeitermythos und Chargesheimer lieferte die passenden Schwarzweiß-Fotos dazu, die die Realität so passend abzubilden schienen. In den folgenden Jahrzehnten, in denen die industriellen Grundlagen schwanden, „Strukturwandel“ – welcher auch immer – zum Mantra wurde und Willy Brandt den Himmel wieder blau werden ließ, klafften Image und Realität zunehmend auseinander. Die Einheimischen, aus denen Werbeagenturen die „Ruhris“ aus dem „Pott“ machten, wurden nicht müde, auf die epochalen Veränderungen hinzuweisen, die der Strukturwandel hervorbrachte und sie freuten sich über Sätze der Besucher wie „Es ist ja alles so grün hier“, denn sie sahen sich in ihren eigenen Einschätzungen bestätigt. Zwanzig Jahre später begegneten sie demselben Satz mit Ermattung und Resignation, denn er zeigte, dass sich das Image des Ruhrgebiets trotz allem nicht verändert hatte. In Sätzen wie „Ich vermag auch im Hässlichen die Schönheit zu erkennen, ich komme aus dem Ruhrgebiet“ machte sich beim als weltoffen und extrem freundlich verschrienen Einheimischen leichter Sarkasmus breit.
Auf diese oder eine ähnliche Gemütslage trifft dieses Buch, dessen Autor Stefan Thoben von so etwas wie dem anderen sozio-ökonomischen Ende – aus Hannover – kommt und 27 Tage mit dem Fahrrad durch das Ruhrgebiet fährt, Eindrücke aufnimmt und fotografiert. Im Ergebnis gibt es ebendiesen weltoffenen Ruhri, gelegentlich behindert durch sein regionales Idiom von Mangerscher Schönheit, und das ländliche Idyll vor Industriekulisse; die Karl-Ernst Osthaus Villa steht bildlich neben den Schuhkarton-Wohnungen an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße; hinzu treten Pommes rot-weiß und Fußballstadien, Zeche Zollern und Siedlungshäuser mit Eternit-Verkleidung, Street Art und Fördergerüste, Kanalufer, Naturschutzgebiete und Senkungsseen, noch funktionierende Vorortkneipen, Nobelrestaurants und solche mit chinesisch-deutschen-italienischen Spezialitäten, Trinkhallen und anerkannte neue Landmarken, Golfplätze, verstaubte Hotels der 1970er Jahre, Helmut Rahn und Willy Lippens, scheinbar endlose Wellblechfassaden von Poco und künstlerisch gestaltete von Rockwool, Brücken und Industriekultur, Museen und Theater, Baugigantomanie und kitschige Sonnenuntergänge, neue Rockgruppen und die letzten Taubenväter, Duisburger Brautmodenläden und Villa Hügel, Himmelstreppe und Tagesbruch, Wissenschaftspark und Ruhrpark. Dass Thobens Reise nicht auf ein Buchprojekt hin vorbereitet und recherchiert wurde, sondern seine „Grand Tour“ eine persönliche Entdeckungsreise war, ist dem Ergebnis zugutegekommen. Spontane Begegnungen
Ruhrgebiet. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten/ Bergbau. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten
Tina Halberschmidt/Martin Wedau (2021): Ruhrgebiet. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Klartext, Essen, 104 S., ISBN 9783837523836, €14,95
Dieter Bleidick (2021): Bergbau. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Klartext, Essen, 104 S., ISBN 9783837523133, € 14,95
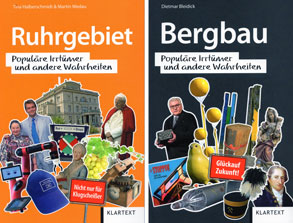
Die Titel beider Taschenbücher sind irreführend; denn präsentiert werden bestenfalls einige konstruierte Irrtümer, vor allem aber eine Reihe von Fakten zum Ruhrgebiet und zu seinem Bergbau. Diese Fakten werden als Wissenshäppchen auf zwei, manchmal auf einer Seite präsentiert und sind mit „Aha“ oder „Aha EXTRA“ markiert (wobei der Unterschied zwischen diesen beiden Markierungen aus dem jeweiligen Inhalt nicht ersichtlich ist). Die extreme Aufsplitterung der qualitativ sehr unterschiedlichen Informationen erscheint weitgehend als der untaugliche Versuch, Leser mit einer vermeintlich geringen Aufmerksamkeitsspanne anzusprechen. Dies führt jedoch auch dazu, dass wirklich interessante Themen, die eine ausführlichere Darstellung verdient hätten, auf rudimentäre Aussagen zusammengestrichen werden.
Die gilt insbesondere für die Veröffentlichung „Ruhrgebiet“, in der ohne roten Faden Wissenswertes, Belangloses (z.B. im Aha-Häppchen über den Rhein) und unnützes Wissen aneinandergereiht wird. Im finalen Quiz lernen Leserin und Leser dann noch, dass die Krim ein Quartier in Recklinghausen ist, dass Hamm (im Übrigen neben anderen Städten!) aufgrund austretender Sole für eine gewisse Zeit Badekurort war und dass Herbert Grönemeyer nicht in Bochum, sondern in Göttingen geboren wurde, James Bond laut seiner fiktiven Biographie dagegen definitiv in Wattenscheid.
Da beide Bücher offensichtlich die ersten in einer sich entwickelnden Reihe sein sollen, wurde auch Bleidicks „Bergbau“ der Portionierung in Aha-Häppchen unterzogen. Methodisch bleibt diese Vorgehensweise auch hier mindestens unvorteilhaft, weil sie der verbindenden Darstellung der einzelnen Themen im Wege steht; allerdings vermochte sie die inhaltliche Qualität kaum zu beeinträchtigen. Trotz aller formalen Beschränkungen ist eine facettenreiche, qualitative und zugleich niederschwellige Darstellung des Ruhrbergbaus gelungen.
Der smarte Ruhrgebietsführer.
Der smarte Ruhrgebietsführer.
Achim Nöllenheidt: RuhrTOUR. Der smarte Ruhrgebietsführer. Kirchen & Klöster. Klartext, Essen 2019, 120 S., ISBN 9783837520798, € 13,95 Achim Nöllenheidt: RuhrTOUR. Der smarte Ruhrgebietsführer. Industriekultur. Klartext, Essen 2019, 120 S., ISBN 9783837520804, € 13,95 Achim Nöllenheidt: RuhrTOUR. Der smarte Ruhrgebietsführer. Museen. Klartext, Essen 2019, 120 S., ISBN 9783837520811, € 13,95 Achim Nöllenheidt: RuhrTOUR. Der smarte Ruhrgebietsführer. Natur pur. Klartext, Essen 2019, 120 S., ISBN 9783837520828, € 13,95 Kompakte Reiseführer sind in. Der Verfasser empfiehlt in den vier Bändchen 70 Kirchen und Klöster, 59 Standorte der Industriekultur, 68 Museen und 55 Naturerlebnisse. Dabei werden in einem handlichen Format für jeden Standort nützliche Basisinformationen wie Adresse, Öffnungszeiten, Internetzugang und eventuelle Führungen sowie Informationen in Text und Foto gegeben. Offensichtlich sind die Bände als Appetizer für Interessierte zu verstehen, denn die Informationstexte sind nicht selten mehr als kurz, smart heißt hier minimalistisch. Wenn es aber denn so sein soll, hätte man den Interessenten wenigstens qualitativ hergestellte Übersichtskarten gönnen können. Da die Standorte in den beigegebenen Karten nicht lagegerecht dargestellt sind, ist es kaum möglich, individuelle Routen zusammenzustellen. Durch den Bund gehend die Innenseiten der Pappumschläge für diese Karten zu nutzen ist zudem eine editorische Katastrophe. Dies ist ebenso wenig smart wie die für Größe und Inhalt der Bändchen völlig überzogenen Preise.Woanders is auch scheiße! Das Ruhrgebiet in den 1980er Jahren.
Woanders is auch scheiße! Das Ruhrgebiet in den 1980er Jahren.
Reinhard Krause. Mit einem Vorwort von Frank Goosen. Emons-Verlag, Köln 2017, 240 S., zahlr. Abbn., ISBN 9783740802318, € 35,00 Die Musik der Achtziger Jahre war furchtbar, die Mode auch und erst recht die Frisuren. Die 1980er waren aber auch Lebenszeit, anderswo wie im Ruhrgebiet. Auch hier war es eine merkwürdige Zeit; mit Frank Goosen war das Alte noch nicht ganz weg und das Neue noch nicht ganz da. Der Fotograf Reinhard Krause öffnete Umzugskartons und stellte seine Bilder jener Zeit, in der Umbruch und Stillstand gleichzeitig waren, zu diesem Bildband zusammen. Es treten zwar auch Arbeiter auf, die für den Erhalt der Arbeitsplätze auf die Straße gehen, aber vor allem sind es private und intime Bilder zum Lebensgefühl jener Jahre. Seltsames wie „Mister Pilswampe“, Herrenkarneval in Recklinghausen und das Männerballett im Revierpark Vonderort steht neben Idyllen wie Sonnenbaden unter Autobahnbrücken und den wunderbar heimeligen Gegensätzen wie Fußballspielen im Schatten des Hochofens oder wie Leben hinter Schallschutzwänden und in den Hochhaussiedlungen der zeitgenössischen Stadterneuerungsprojekte. Das Grauen der Möbelabteilung der Ausstellung „Mode, Heim und Handwerk“ von 1980 steht neben liebevollen Erinnerungen an Büdchen, altbackene Reklameschilder und Telefonzellen im Postamt sowie an Lebensgefühle, die sonnenbräunte Männer im Grugabad, das Generationen umspannende Vergnügen der Cranger Kirmes, Kneipen-Turniere im Skat oder das Abtanzen in Sigis Kalei vermittelten und Mutti isst Tutti frutti bei Toscani. Frank Goosen steuert sein Lebensgefühl jener Jahre und den Titel bei. Schwelgen Sie in Erinnerungen!Zeit-Räume Ruhr. Erinnerungsorte des Ruhrgebiets.
Zeit-Räume Ruhr. Erinnerungsorte des Ruhrgebiets.
Stefan Berger, Ulrich Borsdorf, Ludger Claßen, Henrich Theodor Grütter, Dieter Nellen (Hg.), Klartext, Essen 2019, 942 S., ISBN 9783837519280, zahlr. Abbn., € 39,95 Das seit dem Ende des Kulturhauptstadtjahrs vorangetriebene Projekt „Erinnerungsorte des Ruhrgebiets“ findet mit diesem gewichtigen Band seinen Abschluss. In mehreren Diskussionsstufen und unter Mithilfe der Bürger der Region wurden 266 Erinnerungsorte zusammengetragen, teils konkret lokalisierbar Orte, teils durch Ereignisse und Themen aufgefüllte Bezugspunkte. Aus diesen wurden für diesen Band – ausdrücklich nur bedingt repräsentativ – 49 Erinnerungsorte ausgewählt und den Leitthemen „Landschaft und Stadt“, „Menschen und Typen“, „Industrie und Arbeit“, „Kultur und Freizeit“, „Krisen und Konflikte“ sowie „Mediale Erinnerungsorte“ zugeordnet. Die Herausgeber überführen in der Einleitung die Erinnerungsorte konzeptionell zwar in fluide Zeit-Räume, das Buch bleibt dennoch ein Kaleidoskop unterschiedlicher Themen mit bedingten raumzeitlichen Zusammenhängen, wenngleich für den Sach- oder Regionskundigen mit hohem Erinnerungswert.Großstadt gestalten. Stadtbaumeister an Rhein und Ruhr.
Großstadt gestalten. Stadtbaumeister an Rhein und Ruhr.
Markus Jager/Wolfgang Sonne (Hg.), DOM publishers, Berlin 2016, 237 S., zahlr. Abbn., ISBN 9783869225364, € 38,00 Nur unterbrochen vom Ersten Weltkrieg und den unmittelbaren Nachkriegsjahren, war die Zeit zwischen etwa 1890 und dem Zweiten Weltkrieg für die heutigen Großstädte an Rhein und Ruhr eine Phase wesentlicher architektonischer und städtebaulicher Prägung sowie der Entwicklung einer auf zum Teil umfassenden Plänen basierenden Stadtentwicklung. Als Ergebnisband der 6. Dortmunder Vorträge zur Stadtbaukunst im Jahre 2015 werden diese bis heute nachwirkenden Phasen der Stadtentwicklung für die Städte Köln, Düsseldorf, Essen, Bochum und Dortmund dargestellt. Die Städte an Rhein und Ruhr erfuhren in diesen Jahren mit ihrer Industrialisierung ein starkes Bevölkerungswachstum mit den entsprechenden Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt und für eine geordnete Flächenentwicklung. Sie begannen sich ein monumentales Verwaltungszentrum zu geben und nahmen zeitgenössische städtebauliche Trends begierig auf, in dem Bestreben ganz normale Großstädte zu werden. Das Buch schließt mit einer Diskussion aktueller Vertreter der regionalen Stadtplanung über das Vermächtnis der Stadtbaumeister jener Jahre ab. Das Buch ist sehr gut ausgestattet; hervorzuheben ist insbesondere die qualitativ hochwertige Reproduktion teilweise wenig bekannter Pläne und Karten.Der Wettbewerb Gross-Berlin 1910. Die Entstehung einer modernen Disziplin Städtebau.
Der Wettbewerb Gross-Berlin 1910. Die Entstehung einer modernen Disziplin Städtebau.
Markus Tubbesing, Wasmuth Verlag, Tübingen 2018, 329 S., zahlr. Abbn., ISBN 9783803007810, € 54,00 1910 wurde Berlin zum Schauplatz eines städtebaulichen Großereignisses, des Wettbewerbs Groß-Berlin. Zwar gab es dieses Berlin noch nicht als Verwaltungseinheit, jedoch schon als dynamisch wachsende Metropolregion, der es eine städtebauliche Ordnung zu geben galt. Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich zunächst mit der Entstehung von Groß-Berlin sowie mit den großen städtebaulichen Fragen der damaligen Zeit (Planungskompetenz, Wohnungsfrage, Bodenfrage, Freiflächenfrage, Wasserstraßen), um sich dann der Entstehung der Disziplin Städtebau als einer integrativen Querschnittswissenschaft im Spiegel der Strömungen um 1900 zuzuwenden. Danach werden in großer Breite die verschiedenen städtebaulichen Entwürfe des Wettbewerbs vorgestellt, die verschiedene Ansichten zur Bewältigung von Großstadtproblemen und –anforderungen widerspiegeln. Eine Schlussbetrachtung widmet sich den Auswirkungen für Groß-Berlin einerseits und die Entwicklung des Städtebaus als Disziplin andererseits. Diese beiden spannenden Themen und die insgesamt gute Ausstattung machen die Veröffentlichung attraktiv.Hidden Costs. Ewigkeitslasten.
Hidden Costs. Ewigkeitslasten.
Robert Laube, Fotografien von J. Henry Fair. Klartext, Essen 2018, 119 S., zahlr. Abbn., ISBN 9783837520521, € 19,95 Dies ist ein Band voller attraktiver, ästhetischer (Landschafts-)Fotografien. Erst durch deren Titel und/oder auf den zweiten Blick wird deutlich, dass es sich bei ihnen um künstliche Verformungen der Naturlandschaften oder um Umweltzerstörungen handelt, und meist um nachhaltige bzw. irreversible, die als „versteckte Kosten“ bei der Produktion unserer Güter entstanden sind – verschmutzte Luft, verschmutztes Wasser, zerstörte Lebensräume. Je abstrakter die Bilder dieses Bandes sind, umso größer ist die verstörende Diskrepanz zwischen belastendem Inhalt und formaler Ästhetik – bei Abwasserteichen eines Braunkohlebergwerks, beim Gülle-See aus Schweinefäkalien, bei den Bauxit-Abfällen aus der Aluminiumproduktion oder bei der Berghalde einer arktischen Eisenmine.Verlöschendes Industriezeitalter.
Verlöschendes Industriezeitalter.
Ingrid Krau, Wallstein-Verlag, Göttingen 2018, 144 S., ISBN 9783835332553, € 14,90 Ingrid Krau gibt eine gedrängte Übersicht über den langen Strukturwandel des Ruhrgebiets, teilweise fokussiert auf Duisburg und Gelsenkirchen. Dabei berichtet sie über die Fehlentscheidungen der Großindustrien, die nur zögerlichen Ansätze eines wirtschaftlichen Wandels und eine Stadterneuerung, die retrospektiv als verfehlt oder schädlich angesehen wurde. Sie akzeptiert die neue Ästhetik der Industriekultur, hält jedoch das neue Marketing für falsch und folgt hinsichtlich der Landmarken auf den Halden eher dem üblichen Vorwurf der „Festivalisierung“. Ihre Einschätzung einer ähnelt der des Buches „Viel erreicht, wenig gewonnen“ von Bogumil u.a., ohne jedoch dessen analytische Qualität zu erreichen. Dort wie hier stehen die anhaltenden ökonomischen Schwächen und Fehlentwicklungen im Vordergrund, wohingegen die sozialen und ökologischen Leistungen des regionalen Strukturwandels eher kleingeredet und als letztlich nicht zielführend erachtet werden. Die durchgängig pessimistische Grundstimmung wird am Ende des Buches ein wenig aufgebrochen durch ein Plädoyer für eine breite Bildungsoffensive zur Förderung eines neue regionalen Humankapitals.Archäologische Spuren zum Bergbau in Essen. Vom Steinbeil bis zur Grubenlampe.
Archäologische Spuren zum Bergbau in Essen. Vom Steinbeil bis zur Grubenlampe.
Detlef Hopp (Hg.), Klartext, Essen 2019, 152 S., zahlr. Abbn., ISBN 9783837520705, € 14,95 Der Beitrag des Essener Stadtarchäologen zum Ende des Ruhrbergbaus ist eine Bestandsaufnahme der einschlägigen archäologischen Befunde im Essener Stadtgebiet von der Frühgeschichte bis ins Industriezeitalter. In zeitlicher Abfolge werden die einzelnen Grabungs- und Fundstellen vorgestellt, gelegentlich unterbrochen durch kurze vertiefende Artikel zu Umweltschäden, zur Kriegsgräberstätte der Zeche Graf Beust oder zu den Beziehungen zwischen Gartenzwergen und Bergbau. In den meisten Fällen werden die Befunde in einen größeren historischen oder räumlichen Rahmen gestellt. Vor allem ist dieses Buch aber wieder eines, das Interesse für die faszinierende Welt der Stadtarchäologie weckt, das Arbeitsweisen im Gelände vorführt und auch Zweifel anmeldet, wenn insbesondere Funde der Vor- und Frühgeschichte trotz des ersten Anscheins nicht zwingend eine bergbauliche Verwendung gehabt haben müssen.Geschichte des Bergbaus
Geschichte des deutschen Bergbaus Band 4: Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert.
Geschichte des deutschen Bergbaus Band 4: Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert.
Dieter Ziegler (Hg.), 688 S., zahlr. Abbn., Münster 2013, ISBN 9783402129043, € 89,00 Der vierte Band beginnt mit der Darstellung des Bergbaus in der Kriegswirtschaft. Es folgen Kapitel über den Bergbau in der DDR sowie über den Wiederaufstieg und den Niedergang des westdeutschen Bergbaus. Dieser Wandel war einerseits begleitet von einer dramatischen Entwicklung der Abbautechnik und hatte andererseits weitreichende Implikationen auf die Arbeitsbeziehungen und die Sozialpolitik im Bergbau. Die beiden letzten Kapitel führen die Geschichte des Bergbaus in die Gegenwart mit der Betrachtung der Beziehungen zwischen Bergbau und Umwelt sowie seiner Weiterführung ins 21. Jahrhundert als Teil der Industriekultur.Geschichte des deutschen Bergbaus Band 3: Motor der Industrialisierung. Deutsche Bergbaugeschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Geschichte des deutschen Bergbaus Band 3: Motor der Industrialisierung. Deutsche Bergbaugeschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Klaus Tenfelde (+) und Toni Pierenkemper (Hg.), 631 S., zahlr. Abbn., Münster 2016, ISBN 9783402129036, € 89,00 Im dritten Band ist der Bergbau Grundlage und Motor des Industriezeitalters. Nach einer Einordnung Deutschlands in die bergbaulichen Rohstoffmärkte im 19. und frühen 20. Jahrhundert steht zunächst die produktionstechnische, wirtschaftliche und unternehmerische Entfaltung des Bergbaus einschließlich der sozialen Folgewirkungen im Vordergrund. Der Bergbau und die mit ihm verbundene Montanindustrie löste eine bis dahin nicht gekannte Migration und in Folge eine umfangreiche Stadtentwicklung aus. Aus seiner Sonderstellung entwickelten sich zum einen spezifische Arbeitsbeziehungen und ein besonderes Verhältnis zur Politik. Daraus und infolge des weitreichenden Aufschwung ergab sich die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Bergrechts. Auch dieser Band schließt mit einem Kapitel über den Bergbau als Thema der Kunst ab. Die seit etwa 1850 verlässlich vorhandenen statistischen Daten und das neue Medium der Fotografie ermöglichen eine solide und ansprechende Ausstattung dieses Bandes; hinzu treten im Kapitel zur Stadtentwicklung gut ausgearbeitete Karten.Geschichte des deutschen Bergbaus Band 2: Salze, Erze und Kohlen. Der Aufbruch in die Moderne im 18. und frühen 19. Jahrhundert.
Geschichte des deutschen Bergbaus Band 2: Salze, Erze und Kohlen. Der Aufbruch in die Moderne im 18. und frühen 19. Jahrhundert.
Wolfhard Weber (Hg.), 651 S., zahlr. Abbn., Münster 2015, ISBN 9783402129029, € 89,00 Der zweite Band hat drei Schwerpunkte. Zunächst wird – bei wachsender wirtschaftlicher Bedeutung des Bergbaus und seiner räumlichen Ausdehnung der Einflussnahme der Landesherren auf den Bergbau und das Salzwesen und der damit einhergehenden Entwicklung verschiedener Formen des Bergrechts bis zum (preußischen) Berggesetz von 1865 der notwendige breite Raum gegeben. Von weiterer Bedeutung sind die Fortschritte in der Bergbautechnik beim Erschließen und Fördern sowie das Aufkommen einer Montanwissenschaft, die ihren Ausdruck in der Gründung von Bergakademien findet. Wie schon im ersten Band wird auch hier schließlich die Weiterentwicklung der Bergstädte in den verschiedenen Revieren sowie die Ausprägungen der Montankultur über fünf Jahrhunderte hinweg behandelt.Geschichte des deutschen Bergbaus Band 1: Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
Geschichte des deutschen Bergbaus Band 1: Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
Christoph Bartels und Rainer Slotta (Hg.),699 S., zahlr. Abbn., Münster 2012, ISBN 9783402129012, € 89,00 Der erste Band geht aus von den vor- und frühgeschichtlichen Bergbauzeugnissen, führt durch die mittelalterlichen Blüte- und Krisenzeiten des Bergbaus und berücksichtigt dabei dessen Auswirkungen auf die Territorial-, Landschafts- und Siedlungsentwicklung, die sich entwickelnden/ändernden Arbeitsverhältnisse sowie die Verbindungen zwischen Bergbau und bergbaubezogenem Handel. Besondere Aufmerksamkeit erfährt die Blütezeit des Silberbergbaus und dessen Einflüsse auf die Kunst. Unter den qualitativ hochwertigen Abbildungen sind besonders die Darstellungen zur Schacht- und Stollentechnik sowie die Karten der neu gegründeten Bergstädte hervorzuheben.Geschichte des deutschen Bergbaus
Geschichte des deutschen Bergbaus (4 Bände)
Stefan Berger, Jürgen Mittag, Walther Müller-Jentsch, Eberhard Schmitt, Hans-Christoph Seidel, Klaus Tenfelde (+), K. Rainer Trösken (Hg.), Aschendorff Verlag Band 1: Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, herausgegeben von Christoph Bartels und Rainer Slotta, 699 S., zahlr. Abbn., Münster 2012, ISBN 9783402129012, € 89,00 Band 2: Salze, Erze und Kohlen. Der Aufbruch in die Moderne im 18. und frühen 19. Jahrhundert, herausgegeben von Wolfhard Weber, 651 S., zahlr. Abbn., Münster 2015, ISBN 9783402129029, € 89,00 Band 3: Motor der Industrialisierung. Deutsche Bergbaugeschichte im 19. Und frühen 20. Jahrhundert, herausgegeben von Klaus Tenfelde (+) und Toni Pierenkemper, 631 S., zahlr. Abbn., Münster 2016, ISBN 9783402129036, € 89,00 Band 4: Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert, herausgegeben von Dieter Ziegler, 688 S., zahlr. Abbn., Münster 2013, ISBN 9783402129043, € 89,00 Am Ende des aktiven Ruhrbergbaus erscheint es angebracht, auf dieses vierbändige Werk hinzuweisen, das die Qualität eines Standardwerks hat. Noch von Klaus Tenfelde konzipiert, selbst durch eigene Berufserfahrung dem Bergbau verbunden und international anerkannter Lehrstuhlinhaber und Direktor des Instituts für soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum, erschien es nach seinem Tod und liegt seit 2016 vollständig vor. Renommierte Sachkenner breiten in zeitlich abgegrenzten Bänden auf über 2500 Seiten die Geschichte des deutschen Bergbaus aus, nicht nur des Kohlenbergbaus, sondern auch des Abbaus von Erzen und Salzen. Diese vierbändige Geschichte des deutschen Bergbaus ist ein unverzichtbares Standardwerk mit einem breiten, aber in sich konsistenten Themenspektrum. Der hohe Preis dürfte die vier Bände insgesamt eher zu einem Bibliothekswerk machen, allerdings sind die Einzelbände in sich so weit abgeschlossen, dass sie auch getrennt voneinander zur privaten Anschaffung empfohlen werden können.Essener Streifzüge. Aufbruch zum Jugendstil.
Essener Streifzüge. Aufbruch zum Jugendstil.
Robert Welzel: Essener Streifzüge. Aufbruch zum Jugendstil. Klartext, Essen 2018, 240 S., zahlr. Abbn., ISBN 9783837520347, € 12,95 Im dritten Teil der Essener Streifzüge präsentiert Robert Welzel in 13 Annäherungen (Aufbrüchen) Häuser, Siedlungen und Objekte des Jugendstils in Essen. Diese werden mit historischen und aktuellen Fotos in den inhaltlichen Kontext gestellt. Beigegeben sind dem uneingeschränkt empfehlenswerten Band eine Übersichtskarte der Objekte und für den eigenen Nachgang Stadtteilkarten mit der Objektlokalisation sowie englische, niederländische und türkische Kapitelzusammenfassungen.Essen. Geschichte einer Großstadt im 20. Jahrhundert.
Essen. Geschichte einer Großstadt im 20. Jahrhundert.
Klaus Wisotzky/Monika Josten (Hg.), Aschendorff, Münster 2018, 229 S., ISBN 9783402133934, € 24,95 Im Jahre 1995 übernahm Klaus Wisotzky das Essener Stadtarchiv und wandelte die bis dahin vor sich hin dämmernde städtische Dienststelle in eine lebendige stadthistorische Forschungsstätte. 2009 entstand durch und mit ihm das den Essener Bürgerinnen und Bürgern zugewandte „Haus der Essener Geschichte“ mit zugänglichen Archivbeständen, Lesesaal, Vorträgen und einer Dauerausstellung. Dem häufig geäußerten Wunsch, zu dieser Dauerausstellung einen Katalog zu veröffentlichen, kommt Klaus Wisotzky mit dieser letzten Publikation im aktiven Dienst nach. In reicher Bebilderung zeichnet der Band vor allem die politische und soziale Entwicklung der Stadt Essen seit 1900 nach. Er ist jedem Ausstellungsbesucher, aber auch allen anderen zu empfehlen.Industrie wird Natur. Postindustrielle Repräsentationen von Region und Umwelt im Ruhrgebiet.
Industrie wird Natur. Postindustrielle Repräsentationen von Region und Umwelt im Ruhrgebiet.
Pia Eiringhaus, Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets, Schriften 40, Bochum 2018, 69 S., ISBN 9783837520255, € 3,90 Seit den Zeiten der Internationalen Bauausstellung Emscher Park (IBA, 1989-1999) gibt es im Ruhrgebiet zwei neue Narrative – die baulichen Zeugen der industriellen Entwicklung wurden zur Industriekultur und die Vegetation auf Industriebrachen zur Industrienatur. Ereignisse wie die Kulturhauptstadt und die Verleihung des Titels „Grüne Hauptstadt Europas“ an die Stadt Essen stehen damit in engem Zusammenhang. Welche neuen Erzählungen sind damit verbunden und welcher Imagewandel? Welche neuen Formen von Identifikation, Ästhetik und Ökologie sind entstanden? Die Verfasserin geht in diesem Zusammenhang den Fragen der Rückeroberung und Versöhnung mit der Natur sowie der Betrachtung der Industrienatur als Teil der regionalen Identifikation nach und stellt den Landschaftspark Duisburg-Nord als Tableau ihrer Sichtweisen vor. Sie analysiert die Industrienatur in der regionalen Geschichtsbetrachtung des Ruhr-Museums und bietet abschließend einen Diskurs über das Verhältnis von Mensch und Natur in der postindustriellen Gesellschaft. Insgesamt ist die Veröffentlichung im Gemenge der großen Bildbände zu Industrienatur und Industriekultur, einschließlich des damit verbundenen Marketinggetöses, eine kleine kritische und lesenswerte Schrift.Grubengold. Das Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute.
Grubengold. Das Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute.
Franz-Josef Brüggemeier, C.H. Beck, München 2018, 456 S, ISBN 9783406722219, € 29,95 Im letzten Jahr des aktiven Ruhrbergbaus kehrt Franz-Josef Brüggemeier am Ende seines Berufslebens noch einmal zu dem Thema zurück, mit dem für ihn alles begann, den Bergbau. In zeitlichen Phasen seit der Mitte des 18. Jhs. wendet er sich den sich wandelnden Produktionsmethoden, den Arbeitsverhältnissen der Bergleute, den Unternehmertypen und ihren Risiken, dem Produktionsstammbaum der Kohle und den Auswirkungen der Nebenprodukte auf die Entwicklung von Industrie und Lebensraum, den Veränderungen und Belastungen ebendieses Lebensraums, der kriegswirtschaftlichen Bedeutung der Kohle, den Konkurrenten auf den Energiemarkt und schließlich den Schließungen und den damit verbundenen Protesten, Subventionen und Nachwirkungen zu. Im Mittelpunkt steht zwar der regionale Bergbau, aber es werden immer auch europäische Vergleiche und Bezüge hergestellt. Statistisches Zahlenmaterial ist sparsam gesetzt, die Abbildungen sind sorgsam ausgesucht. Hier ist jemand einen Schritt vom Thema zurückgetreten, erkennt das Grundsätzliche und die großen Linien und entwickelt mit langer Forschungserfahrung und leichter Hand eine Geschichte mit vielen Facetten – ein lesenswertes Buch.In Weiß. Essener Architektur zwischen Bauhaus und Gegenwart.
In Weiß. Essener Architektur zwischen Bauhaus und Gegenwart
Peter Brdenk/Wolfgang Kleber, Klartext, Essen 2019, 110 S., zahlr. Abbn., ISBN 9783837520309, € 19,95 Zum Hundertjährigen der Bauhausidee legen die beiden Autoren diesen Band vor, in dem zum einen die Beziehungen zwischen der Dessauer Idee und dem zeitgenössischen Bauen in Essen herausgearbeitet werden und zum anderen über die vom Bauhaus bevorzugte Farbe Weiß Entwicklungslinien bis zu den Gegenwartsbauten in Essen gezogen werden. Einem instruktiven Textteil, der die formale und konzeptionelle Entwicklung und globale Diffusion der Bauhausidee nachzeichnet, folgt ein Bildteil mit weißen Häusern in Essen, mehrheitlich Beispiele der Gegenwartsarchitektur. Die Bildkonzeption des Buches ist schwarz-weiß ausgelegt, wenngleich die meisten weißen Gebäude der Gegenwartsarchitektur auch Farbaufnahmen vertragen hätten. Insgesamt stellt die Veröffentlichung eine gelungene Fortsetzung der von den beiden Autoren herausgegebenen Reihe zur Stadtarchitektur Essens dar.Was von der Zeche bleibt. Bilder nach der Kohle
Was von der Zeche bleibt. Bilder nach der Kohle
Langmach, Bernd, Was von der Zeche bleibt. (Herausg. v. Heinrich Theodor Grütter). Essen (Klartext) 2018, 215 S., ISBN 978-3-8375-1952-5, € 29,95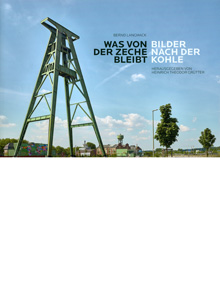 Dieses Buch zeigt nur „Bilder einer Ausstellung“. Ebenfalls aus Anlass des Endes des Bergbaus stellte der Fotograf Bernd Langmach seine Aufnahmen von stillgelegten, funktionslosen und neu genutzten Schachtanlagen aus – mittendrin, nah dran oder weit weg in der Landschaft. In vielen bergbaulichen Bildbänden, die in den letzten Jahren – zum Teil als reprints – erschienen, sind uns Zechenanlagen in unterschiedlichen Sichtweisen präsentiert worden; Chargesheimer und die Bechers wurden zu Stilikonen. Hier erfahren wir, Schwarz-weiß und in Farbe, andere, teilweise auch frischere, in jedem Fall aber konkurrenzfähige Sichtweisen – sachlich, melancholisch, formalistisch, kitschig.
Dieses Buch zeigt nur „Bilder einer Ausstellung“. Ebenfalls aus Anlass des Endes des Bergbaus stellte der Fotograf Bernd Langmach seine Aufnahmen von stillgelegten, funktionslosen und neu genutzten Schachtanlagen aus – mittendrin, nah dran oder weit weg in der Landschaft. In vielen bergbaulichen Bildbänden, die in den letzten Jahren – zum Teil als reprints – erschienen, sind uns Zechenanlagen in unterschiedlichen Sichtweisen präsentiert worden; Chargesheimer und die Bechers wurden zu Stilikonen. Hier erfahren wir, Schwarz-weiß und in Farbe, andere, teilweise auch frischere, in jedem Fall aber konkurrenzfähige Sichtweisen – sachlich, melancholisch, formalistisch, kitschig.Das Zeitalter der Kohle. Eine europäische Geschichte. Katalogbuch zur Ausstellung des RuhrMuseums und des Deutschen Bergbau-Museums.
Das Zeitalter der Kohle. Eine europäische Geschichte. Katalogbuch zur Ausstellung des RuhrMuseums und des Deutschen Bergbau-Museums.
Brüggemeier, Franz-Josef/Farrenkopf, Michael/Grütter, Heinrich Theodor (Hg.). Essen (Klartext) 2018, 286 S., ISBN 978-3-8375-1953-2, € 24,95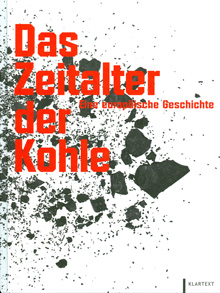 Das Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland hat in diesem Jahr eine Kaskade von einschlägigen Büchern zu diesem Thema in unterschiedlicher Qualität hervorgerufen; dieses ist ein lesenswertes. Mit Blick auf den Bergbau als ein europäisches Phänomen und reich mit wenig bekannten und unbekannten Abbildungen bebildert, wird – weitgehend abgeleitet am Produktionsstammbaum – in sieben Kapiteln ein wirtschaftliches, politisches und soziales Kaleidoskop rund um die Kohle, den Bergbau, die Bergbaugesellschaften, den Bergbau in der Gesellschaft, Bergbaulandschaften und die damit verbundenen Wandlungsprozesse präsentiert. Dieses Buch ist nur vordergründig ein Ausstellungskatalog, sondern beleuchtet auch eigenständig die vielfältigen Aspekte des europäischen Bergbaus seit über 150 Jahren.
Das Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland hat in diesem Jahr eine Kaskade von einschlägigen Büchern zu diesem Thema in unterschiedlicher Qualität hervorgerufen; dieses ist ein lesenswertes. Mit Blick auf den Bergbau als ein europäisches Phänomen und reich mit wenig bekannten und unbekannten Abbildungen bebildert, wird – weitgehend abgeleitet am Produktionsstammbaum – in sieben Kapiteln ein wirtschaftliches, politisches und soziales Kaleidoskop rund um die Kohle, den Bergbau, die Bergbaugesellschaften, den Bergbau in der Gesellschaft, Bergbaulandschaften und die damit verbundenen Wandlungsprozesse präsentiert. Dieses Buch ist nur vordergründig ein Ausstellungskatalog, sondern beleuchtet auch eigenständig die vielfältigen Aspekte des europäischen Bergbaus seit über 150 Jahren. Die Entwicklung neuer Stadtquartiere aus städtebaulicher Sicht. Analyse der Projekte seit 1990.
Die Entwicklung neuer Stadtquartiere aus städtebaulicher Sicht. Analyse der Projekte seit 1990.
Guhl, Pascal. Dortmunder Beiträge zur Raumplanung, Band 148, Essen (Klartext) 2018, 366 S., ISBN 978-3-8375-2021-7, € 29,95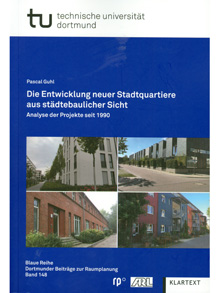 Die räumliche Ebene der Stadtquartiere hat in den letzten Jahren in der städtebaulichen Praxis und in der sozialen Stadtentwicklungsplanung eine erhebliche Bedeutung gewonnen. Die steigende Zahl dieser Quartiere zeigt diese Bedeutung und ermöglicht auch eine breiter gefächerte vergleichende Untersuchung. Durch den empirischen Vergleich von 435 neuen Stadtquartieren gelingen Einsichten über den Stellenwert des Wohnens, die Verfahren und Instrumente der Implementierung und ihre städtebauliche Qualität. Unter Anwendung dieser Erkenntnisse und methodisch mit Hilfe von Experteninterviews werden schließlich vier Beispielquartiere – in Frankfurt, München, Potsdam und Freiburg – untersucht. Wie wurden die Projekte durchgeführt, welches waren die Einflussfaktoren auf den Prozess, welchen Stellenwert hatte die Bürgerbeteiligung und welche städtebaulichen Ziele und Qualitäten konnten erreicht werden, dies sind die Fragestellungen, die abschließend beantwortet werden. In einer Zeit, in der der Wohnungsbau, insbesondere auch ein wiederbelebter öffentlicher Wohnungsbau, eine besondere Rolle in der Stadtentwicklung spielen, gibt dieser empfehlenswerte Band einige wichtige Einsichten.
Die räumliche Ebene der Stadtquartiere hat in den letzten Jahren in der städtebaulichen Praxis und in der sozialen Stadtentwicklungsplanung eine erhebliche Bedeutung gewonnen. Die steigende Zahl dieser Quartiere zeigt diese Bedeutung und ermöglicht auch eine breiter gefächerte vergleichende Untersuchung. Durch den empirischen Vergleich von 435 neuen Stadtquartieren gelingen Einsichten über den Stellenwert des Wohnens, die Verfahren und Instrumente der Implementierung und ihre städtebauliche Qualität. Unter Anwendung dieser Erkenntnisse und methodisch mit Hilfe von Experteninterviews werden schließlich vier Beispielquartiere – in Frankfurt, München, Potsdam und Freiburg – untersucht. Wie wurden die Projekte durchgeführt, welches waren die Einflussfaktoren auf den Prozess, welchen Stellenwert hatte die Bürgerbeteiligung und welche städtebaulichen Ziele und Qualitäten konnten erreicht werden, dies sind die Fragestellungen, die abschließend beantwortet werden. In einer Zeit, in der der Wohnungsbau, insbesondere auch ein wiederbelebter öffentlicher Wohnungsbau, eine besondere Rolle in der Stadtentwicklung spielen, gibt dieser empfehlenswerte Band einige wichtige Einsichten.Lebe dein grünes Wunder – Green up your life. Ein Jahr, Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017/One Year, European Green Capital – Essen 2017.
Lebe dein grünes Wunder – Green up your life. Ein Jahr, Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017/One Year, European Green Capital – Essen 2017.
Stadt Essen (Hg.). Essen (Klartext) 2018, 272 S., ISBN 978-3-8375-2019-4, € 24,95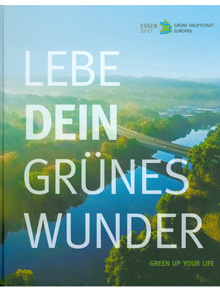 Dies ist der zweisprachige (deutsch/englisch) „Rechenschaftsbericht“ der Stadt Essen und ihres Projektbüros Grüne Hauptstadt Europas über das im Jahr 2017 Erreichte. Nach einer Einleitung unter dem bekannten Slogan „Von Grau zu Grün“ werden in zehn Kapiteln und in guter fotografischer Ausstattung die erfolgreichen Projekte des Jahres vorgestellt. Die beiden letzten Kapitel umfassen positive Absichtsbekundungen von einschlägigen Unternehmen sowie einen Einschätzung mit Ausblick. Hier hätte man zumindest zwei kritische Anmerkungen erwartet. Zum einen wird zwar referiert, dass die Mehrheit der Essener Bevölkerung die Grüne Hauptstadt lediglich für eine große Marketingveranstaltung hält und zudem die Lebensqualität in Essen nicht verbessert, doch wird dies nicht kommentiert und die eigene Vorgehensweise hinterfragt. Welche Erfolge aber wie nachhaltig verstetigt werden sollen und wie man mit den nicht erfolgreichen Projekten des Jahres 2017 umzugehen gedenkt, bleibt unbeantwortet. Da aber mit der Verleihung des Hauptstadttitels auch der Nachweis der Nachhaltigkeit der Projekte und Maßnahmen verbunden ist, wird man in wenigen Jahren dieses ambitionierte Ziel noch einmal aufgreifen (müssen).
Dies ist der zweisprachige (deutsch/englisch) „Rechenschaftsbericht“ der Stadt Essen und ihres Projektbüros Grüne Hauptstadt Europas über das im Jahr 2017 Erreichte. Nach einer Einleitung unter dem bekannten Slogan „Von Grau zu Grün“ werden in zehn Kapiteln und in guter fotografischer Ausstattung die erfolgreichen Projekte des Jahres vorgestellt. Die beiden letzten Kapitel umfassen positive Absichtsbekundungen von einschlägigen Unternehmen sowie einen Einschätzung mit Ausblick. Hier hätte man zumindest zwei kritische Anmerkungen erwartet. Zum einen wird zwar referiert, dass die Mehrheit der Essener Bevölkerung die Grüne Hauptstadt lediglich für eine große Marketingveranstaltung hält und zudem die Lebensqualität in Essen nicht verbessert, doch wird dies nicht kommentiert und die eigene Vorgehensweise hinterfragt. Welche Erfolge aber wie nachhaltig verstetigt werden sollen und wie man mit den nicht erfolgreichen Projekten des Jahres 2017 umzugehen gedenkt, bleibt unbeantwortet. Da aber mit der Verleihung des Hauptstadttitels auch der Nachweis der Nachhaltigkeit der Projekte und Maßnahmen verbunden ist, wird man in wenigen Jahren dieses ambitionierte Ziel noch einmal aufgreifen (müssen). Groß denken, groß handeln. Wandel, Bruch, Umbruch: Wie sich das Ruhrgebiet neu erfindet.
Groß denken, groß handeln. Wandel, Bruch, Umbruch: Wie sich das Ruhrgebiet neu erfindet.
Spörl, Gerhard. München/Berlin/Zürich (Piper) 2017, 288 S. ISBN 978-3-492-05849-0, € 22,00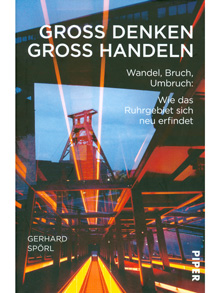 Dieses Buch ist die ausgedehnte Reportage eines Außenstehenden aus Oberfranken (Journalist bei ZEIT und SPIEGEL), die die Entwicklung des Ruhrgebiets seit 1945 bis 2018, d.h. über weite Teile die Periode des Strukturwandels darzustellen sich anschickt. Auslöser ist wieder die endgültige Stilllegung des Ruhrbergbaus, und über weite Strecken stehen die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorgänge, die der phasenweisen Stilllegung des Ruhrbergbaus voraus- bzw. mit ihr einhergingen im Mittelpunkt der Darstellung. Verwoben wird die Faktenerzählung mit der aus Interviews hervorgegangene Charakterisierung von namhaften und für das Ruhrgebiet bedeutsamen Einzelpersonen; dabei wird nur wenig kaschiert, dass das Buch über weite Strecken eine Hommage an Werner Müller ist. Es war allerdings unnötig, dessen Verdienste für den Insider dadurch zu diskreditieren, dass er ihn in die sattsam bekannte Argumentation einbindet, dass das Ruhrgebiet immer die Heilsbringer von außen brauchte, um seine Probleme zu lösen oder neue Impulse zu empfangen. Das Buch ist zweifellos ordentlich recherchiert und das vom Autor immer wieder umkreiste „Narrativ“ ist weitgehend zutreffend. Für den „Ruhri“ – hier sei er aus terminologischen Gründen angeführt – oder für den historischen, politischen oder wirtschaftlichen Insider ist es aber mehr Feuilleton als problemorientierte Analyse. Es ist an Prominenten und weitgehend an exogenen Vorstellungen vom Ruhrgebiet orientiert, vermag jedoch endogene Potentiale und regionale Befindlichkeiten nicht deutlich werden zu lassen, wenngleich schwer vorstellbar ist, dass die Gespräche des Autors mit Stefan Goch und Frank Goosen ihn nicht „ganz nah ran“ geführt haben. Für Einheimische mag das Buch jedoch im Umkehrschluss interessant sein, gibt es doch Einblicke, wie (un)differenziert das Ruhrgebiet von außen noch immer gesehen wird, und zeigt wie schwer es ist, jenseits des vermeintlich Faktischen den „Spirit“ dieser komplexen Region zu erfassen.
Dieses Buch ist die ausgedehnte Reportage eines Außenstehenden aus Oberfranken (Journalist bei ZEIT und SPIEGEL), die die Entwicklung des Ruhrgebiets seit 1945 bis 2018, d.h. über weite Teile die Periode des Strukturwandels darzustellen sich anschickt. Auslöser ist wieder die endgültige Stilllegung des Ruhrbergbaus, und über weite Strecken stehen die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorgänge, die der phasenweisen Stilllegung des Ruhrbergbaus voraus- bzw. mit ihr einhergingen im Mittelpunkt der Darstellung. Verwoben wird die Faktenerzählung mit der aus Interviews hervorgegangene Charakterisierung von namhaften und für das Ruhrgebiet bedeutsamen Einzelpersonen; dabei wird nur wenig kaschiert, dass das Buch über weite Strecken eine Hommage an Werner Müller ist. Es war allerdings unnötig, dessen Verdienste für den Insider dadurch zu diskreditieren, dass er ihn in die sattsam bekannte Argumentation einbindet, dass das Ruhrgebiet immer die Heilsbringer von außen brauchte, um seine Probleme zu lösen oder neue Impulse zu empfangen. Das Buch ist zweifellos ordentlich recherchiert und das vom Autor immer wieder umkreiste „Narrativ“ ist weitgehend zutreffend. Für den „Ruhri“ – hier sei er aus terminologischen Gründen angeführt – oder für den historischen, politischen oder wirtschaftlichen Insider ist es aber mehr Feuilleton als problemorientierte Analyse. Es ist an Prominenten und weitgehend an exogenen Vorstellungen vom Ruhrgebiet orientiert, vermag jedoch endogene Potentiale und regionale Befindlichkeiten nicht deutlich werden zu lassen, wenngleich schwer vorstellbar ist, dass die Gespräche des Autors mit Stefan Goch und Frank Goosen ihn nicht „ganz nah ran“ geführt haben. Für Einheimische mag das Buch jedoch im Umkehrschluss interessant sein, gibt es doch Einblicke, wie (un)differenziert das Ruhrgebiet von außen noch immer gesehen wird, und zeigt wie schwer es ist, jenseits des vermeintlich Faktischen den „Spirit“ dieser komplexen Region zu erfassen. RevierGestalten. Von Orten und Menschen. Ausstellungskatalog.
RevierGestalten. Von Orten und Menschen. Ausstellungskatalog.
Flieshart, Jana/Jana Golombek (Hg.). Essen (Klartext) 2018, 151 S., ISBN 978-3-8375-1922-8, € 19,95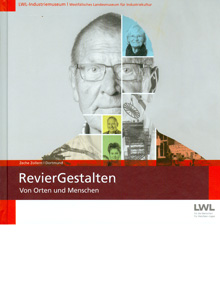 Die endgültige Stilllegung des Ruhrbergbaus im Jahre 2018 nimmt das LWL-Industriemuseum auf der Zeche Zollern zum Anlass, in einer Ausstellung den sich seit Jahrzehnten vollziehenden Strukturwandel an Orten und Menschen nachzuvollziehen, und dies auch im Hinblick auf die Frage, ob diese Orte solche der Erinnerung für Menschen sind, deren Leben von ihnen geprägt wurde und wird. Der erste Teil des Buches handelt von Orten. Unter der Überschrift „Erinnern“ steht die Entwicklung der Industriedenkmalpflege in Westfalen im Vordergrund, das Kapitel „Leben“ beschäftigt sich mit den Arbeitersiedlungsinitiativen in den 1970er Jahren, „Planen“ zeigt die Notwendigkeit und Bedeutung von Stadterneuerung im Strukturwandel auf und im Kapitel „Gestalten“ geht es um die Veränderung von freien/frei gewordenen Räumen und um das Netzwerk „Recht auf Stadt“. Im zweiten Teil geht es um Menschen und ihre Erfahrungen im und mit dem Strukturwandel. Nach einem „Gastkommentar“ aus dem schottischen Kohlerevier um Stirling und einer Fotocollage Dortmunder Zechen werden acht Mehr-Generationen-Familien und ihre Eindrücke in und von den letzten Jahren vorgestellt. Der Band vereinigt viele Ideen zum Thema „Strukturwandel“; von den interessanten und liebevoll aufbereiteten Familieninterviews abgesehen sind aber nur wenige wirklich neu. Vor allem fehlt eine zusammenhaltende Eingangsdarstellung, die die Einzelbeiträge in das Thema einordnet und sich nicht auf eine kursorische Betrachtung über die Arbeit des LWL-Industriemuseums beschränkt.
Die endgültige Stilllegung des Ruhrbergbaus im Jahre 2018 nimmt das LWL-Industriemuseum auf der Zeche Zollern zum Anlass, in einer Ausstellung den sich seit Jahrzehnten vollziehenden Strukturwandel an Orten und Menschen nachzuvollziehen, und dies auch im Hinblick auf die Frage, ob diese Orte solche der Erinnerung für Menschen sind, deren Leben von ihnen geprägt wurde und wird. Der erste Teil des Buches handelt von Orten. Unter der Überschrift „Erinnern“ steht die Entwicklung der Industriedenkmalpflege in Westfalen im Vordergrund, das Kapitel „Leben“ beschäftigt sich mit den Arbeitersiedlungsinitiativen in den 1970er Jahren, „Planen“ zeigt die Notwendigkeit und Bedeutung von Stadterneuerung im Strukturwandel auf und im Kapitel „Gestalten“ geht es um die Veränderung von freien/frei gewordenen Räumen und um das Netzwerk „Recht auf Stadt“. Im zweiten Teil geht es um Menschen und ihre Erfahrungen im und mit dem Strukturwandel. Nach einem „Gastkommentar“ aus dem schottischen Kohlerevier um Stirling und einer Fotocollage Dortmunder Zechen werden acht Mehr-Generationen-Familien und ihre Eindrücke in und von den letzten Jahren vorgestellt. Der Band vereinigt viele Ideen zum Thema „Strukturwandel“; von den interessanten und liebevoll aufbereiteten Familieninterviews abgesehen sind aber nur wenige wirklich neu. Vor allem fehlt eine zusammenhaltende Eingangsdarstellung, die die Einzelbeiträge in das Thema einordnet und sich nicht auf eine kursorische Betrachtung über die Arbeit des LWL-Industriemuseums beschränkt. Steinkohlenzechen – Fotografien aus dem Ruhrgebiet.
Steinkohlenzechen – Fotografien aus dem Ruhrgebiet.
Grütter, Heinrich Theodor/Stefanie Grebe (Hg.), Josef Stoffels. Essen (Klartext) 2018, 334 S. ISBN 978-3-8375-1893-1, € 29,95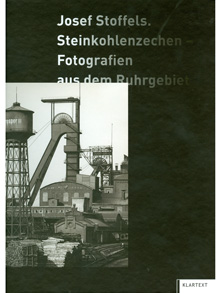 Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 hat das Ruhrmuseum – zu einem nicht geringen Teil basierend auf den eigenen Beständen – den großen Fotografen des Ruhrgebiets Ausstellungen gewidmet – Heinrich Hauser, Chargesheimer, Erich Grisar. Ausgehend von Josef Stoffels Projekt „Steinkohlenzechen“ stehen im Mittelpunkt dieses Begleitbandes zur Ausstellung vor allem Fotos aus den 1950er Jahren, der Zeit zwischen dem Aufschwung der Wirtschaftswunderzeit und der beginnenden Kohlenkrise – von Stoffels in einer Farbbildreihe bzw. einer Schwarzweißbildreihe festgehalten. Neben die Zechenfotos treten Bilder aus dem Alltagsleben der 1950er, Beispiele aus dem fotografischen Schaffen Stoffels in den 1930ern und außerhalb des Bergbaus sowie eine Würdigung als Industriefotograf. Anders als im fotografischen Werk von Hilla und Bernd Becher, die sich um 1970 des Abrisses, zumindest jedoch der grundlegenden Veränderung der von ihnen aus immer derselben Distanz fotografierten Anlagen bewusst waren, sind Stoffels Aufnahmen ungezwungener, konzeptlos spielerischer und häufig der komplexen Faszination der Objekte nachgebend. Daneben stellt sich zumindest für ältere Betrachter die Erkenntnis ein, in welchem Maße die Fotografien Stoffels unseren Blick auf das Ruhrgebiet der 1950er und frühen 960er Jahre geprägt haben. Dieser großformatige Band ist daher mehr als nur ein repräsentatives coffee-table book.
Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 hat das Ruhrmuseum – zu einem nicht geringen Teil basierend auf den eigenen Beständen – den großen Fotografen des Ruhrgebiets Ausstellungen gewidmet – Heinrich Hauser, Chargesheimer, Erich Grisar. Ausgehend von Josef Stoffels Projekt „Steinkohlenzechen“ stehen im Mittelpunkt dieses Begleitbandes zur Ausstellung vor allem Fotos aus den 1950er Jahren, der Zeit zwischen dem Aufschwung der Wirtschaftswunderzeit und der beginnenden Kohlenkrise – von Stoffels in einer Farbbildreihe bzw. einer Schwarzweißbildreihe festgehalten. Neben die Zechenfotos treten Bilder aus dem Alltagsleben der 1950er, Beispiele aus dem fotografischen Schaffen Stoffels in den 1930ern und außerhalb des Bergbaus sowie eine Würdigung als Industriefotograf. Anders als im fotografischen Werk von Hilla und Bernd Becher, die sich um 1970 des Abrisses, zumindest jedoch der grundlegenden Veränderung der von ihnen aus immer derselben Distanz fotografierten Anlagen bewusst waren, sind Stoffels Aufnahmen ungezwungener, konzeptlos spielerischer und häufig der komplexen Faszination der Objekte nachgebend. Daneben stellt sich zumindest für ältere Betrachter die Erkenntnis ein, in welchem Maße die Fotografien Stoffels unseren Blick auf das Ruhrgebiet der 1950er und frühen 960er Jahre geprägt haben. Dieser großformatige Band ist daher mehr als nur ein repräsentatives coffee-table book. Jenseits des Gebauten. Öffentliche Räume in der Stadt.
Jenseits des Gebauten. Öffentliche Räume in der Stadt.
Leyser-Droste, Magdalena et al., Beiträge zur städtebaulichen Denkmalpflege 8, Essen (Klartext) 2018, 144 S., ISBN 978-3-8375-1908-2, € 17,95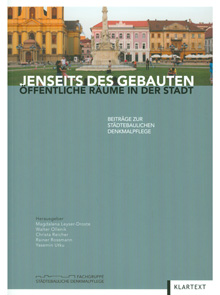 Seit es Städte gibt, ist der öffentliche Raum ein konstituierender formaler, struktureller und funktionaler Bestandteil. Im Verlauf der Stadtentwicklung wandelten sich Form, Funktion und Sinnhaftigkeit mehrfach. Aktuellen Problemstellungen, die sich für den öffentlichen Raum zwischen Veränderung und bewahrendem Schutz ergeben, geht dieser kleine Band nach, der die Vorträge einer Tagung im Oktober 2016 zusammenfasst. Der öffentliche Raum in der kommunalen Kulturpolitik, als Ort von Repräsentation oder Aneignung – wenn dies denn ein Gegensatz sein muss -, als Mittel zur Heilung obsoleter oder unerwünschter städtischer Strukturen bzw. als grundsätzlicher Potentialraum sind Themen dieses Bandes. Bei einigen vorgestellten Planungen erscheint der öffentliche Raum so sehr von den gegenwärtigen Vorstellungen der Planer hinsichtlich der partizipatorischen Aneignung der Stadt betroffen, dass seine ursprüngliche Beliebigkeit der Nutzung rigide und manchmal mit irreversiblen Umbauten kanalisiert wird. Dieser Spannung wird die wohltuende Betrachtung gegenübergestellt, dass der Raum selbst das Objekt der Betrachtung sein kann und einen Eigenwert hat; ein solcher Ansatz macht den öffentlichen Raum allerdings noch anfälliger gegenüber einem wachsenden Druck, der auf eine optimal profitable Nutzung des (inner-)städtischen Bodens abzielt. Insgesamt ist es ein lesenswerter Band, der die gegenwärtigen kontroversen Möglichkeiten und Ansichten widerspiegelt.
Seit es Städte gibt, ist der öffentliche Raum ein konstituierender formaler, struktureller und funktionaler Bestandteil. Im Verlauf der Stadtentwicklung wandelten sich Form, Funktion und Sinnhaftigkeit mehrfach. Aktuellen Problemstellungen, die sich für den öffentlichen Raum zwischen Veränderung und bewahrendem Schutz ergeben, geht dieser kleine Band nach, der die Vorträge einer Tagung im Oktober 2016 zusammenfasst. Der öffentliche Raum in der kommunalen Kulturpolitik, als Ort von Repräsentation oder Aneignung – wenn dies denn ein Gegensatz sein muss -, als Mittel zur Heilung obsoleter oder unerwünschter städtischer Strukturen bzw. als grundsätzlicher Potentialraum sind Themen dieses Bandes. Bei einigen vorgestellten Planungen erscheint der öffentliche Raum so sehr von den gegenwärtigen Vorstellungen der Planer hinsichtlich der partizipatorischen Aneignung der Stadt betroffen, dass seine ursprüngliche Beliebigkeit der Nutzung rigide und manchmal mit irreversiblen Umbauten kanalisiert wird. Dieser Spannung wird die wohltuende Betrachtung gegenübergestellt, dass der Raum selbst das Objekt der Betrachtung sein kann und einen Eigenwert hat; ein solcher Ansatz macht den öffentlichen Raum allerdings noch anfälliger gegenüber einem wachsenden Druck, der auf eine optimal profitable Nutzung des (inner-)städtischen Bodens abzielt. Insgesamt ist es ein lesenswerter Band, der die gegenwärtigen kontroversen Möglichkeiten und Ansichten widerspiegelt. In großem Maßstab. Riesen in der Stadt.
In großem Maßstab. Riesen in der Stadt.
Utku, Yasemin et al., In großem Maßstab. Riesen in der Stadt. Beiträge zur städtebaulichen Denkmalpflege 7, Essen (Klartext) 2017, 222 S, ISBN 978-3-3875-1703-3, € 19,95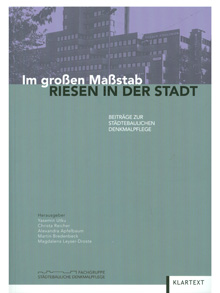 In der gegenwärtigen (deutschen) Diskussion wird die kleinteilige Stadt mit hoher Nutzungsmischung als die nachhaltigste Stadt angesehen. In vielen der heutigen Städte stehen dieser Auffassung jedoch weitgehend monofunktionale Großbauten des Wohnens, der Bildung, des Handels, des Verkehrs und der Verwaltung entgegen, die in den 1960er und 1970er Jahren als zeitgemäße städtische Formen errichtet wurden. Nach über 40 Jahren stehen sie häufig unter Veränderungsdruck oder sind sanierungsbedürftig. Ist nun der Zeitpunkt gekommen, diese mehrheitlich nicht geliebte Bausubstanz widerspruchsfrei zu entsorgen oder haben sie mittlerweile den Status eines Denkmals für eine bestimmte Phase unseres Städtebaus erreicht? Welche Potentiale der Weiterentwicklung haben sie? Nach einer Einleitung geht der vorliegende Band in 14 Beiträgen diesen Fragen nach. Diskutierte Beispiele sind Düsseldorf, Bochum, Wulfen, Dortmund, Marl, Bonn, Berlin, Stuttgart sowie Kaufhäuser und Einkaufszentren in ganz Deutschland. Insgesamt gibt der Band eine gute Einführung in eine notwendige städtebauliche Diskussion.
In der gegenwärtigen (deutschen) Diskussion wird die kleinteilige Stadt mit hoher Nutzungsmischung als die nachhaltigste Stadt angesehen. In vielen der heutigen Städte stehen dieser Auffassung jedoch weitgehend monofunktionale Großbauten des Wohnens, der Bildung, des Handels, des Verkehrs und der Verwaltung entgegen, die in den 1960er und 1970er Jahren als zeitgemäße städtische Formen errichtet wurden. Nach über 40 Jahren stehen sie häufig unter Veränderungsdruck oder sind sanierungsbedürftig. Ist nun der Zeitpunkt gekommen, diese mehrheitlich nicht geliebte Bausubstanz widerspruchsfrei zu entsorgen oder haben sie mittlerweile den Status eines Denkmals für eine bestimmte Phase unseres Städtebaus erreicht? Welche Potentiale der Weiterentwicklung haben sie? Nach einer Einleitung geht der vorliegende Band in 14 Beiträgen diesen Fragen nach. Diskutierte Beispiele sind Düsseldorf, Bochum, Wulfen, Dortmund, Marl, Bonn, Berlin, Stuttgart sowie Kaufhäuser und Einkaufszentren in ganz Deutschland. Insgesamt gibt der Band eine gute Einführung in eine notwendige städtebauliche Diskussion.The Complete Ruhrgebiet. The English Language Guide. For residents and visitors alike.
The Complete Ruhrgebiet. The English Language Guide. For residents and visitors alike.
Kift, Roy. Essen (Klartext) 2018, 5. neubearbeitete Ausgabe, 288 S., ISBN 978-3-8375-1876-4, € 14,95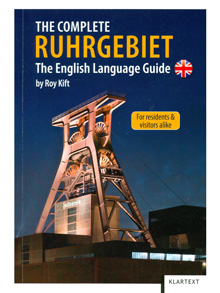 “My intention is to acquaint you with the many highlights in the area, help you to master the difficulties of getting around in country whose language you might not understand, and point you in the right direction to enable you to make further discoveries for yourself in one of the most fascinating areas in Germany. Despite its five million or so inhabitants the Ruhrgebiet is not London and it’s not New York. It’s not even Berlin, thank God. And it’s most definitely not Majorca, although it also has plenty of fine places for you to laze around in the sun. Nobody in their right mind would claim the region is an Elysium of unmitigated beauty but it’s million times greener and cleaner than its reputation.” Damit umschreibt Roy Kift die Intention seines Buches. Es ist ein gut recherchierter Reiseführer und Sie kennen die meisten der vorgestellten „Highlights“. So weit, so gut Aber es ist ein besonderes Vergnügen, Bekanntes aus der Sicht von Besuchern sehen zu können oder zu erleben, wie nicht Deutsch Sprechende mit unseren Alltäglichkeiten klarkommen müssen – allein die Beschreibung des Lösens eines Tickets am VRR-Ticketautomat ist ein Kabinettstückchen. Wer Spaß an den Feinheiten der englischen Sprache hat, hat einen besonderen Genuss – it’s great fun.
“My intention is to acquaint you with the many highlights in the area, help you to master the difficulties of getting around in country whose language you might not understand, and point you in the right direction to enable you to make further discoveries for yourself in one of the most fascinating areas in Germany. Despite its five million or so inhabitants the Ruhrgebiet is not London and it’s not New York. It’s not even Berlin, thank God. And it’s most definitely not Majorca, although it also has plenty of fine places for you to laze around in the sun. Nobody in their right mind would claim the region is an Elysium of unmitigated beauty but it’s million times greener and cleaner than its reputation.” Damit umschreibt Roy Kift die Intention seines Buches. Es ist ein gut recherchierter Reiseführer und Sie kennen die meisten der vorgestellten „Highlights“. So weit, so gut Aber es ist ein besonderes Vergnügen, Bekanntes aus der Sicht von Besuchern sehen zu können oder zu erleben, wie nicht Deutsch Sprechende mit unseren Alltäglichkeiten klarkommen müssen – allein die Beschreibung des Lösens eines Tickets am VRR-Ticketautomat ist ein Kabinettstückchen. Wer Spaß an den Feinheiten der englischen Sprache hat, hat einen besonderen Genuss – it’s great fun.Robert Schmidt 1869-1934. Stadtbaumeister in Essen und Landesplaner im Ruhrgebiet.
Robert Schmidt 1869-1934. Stadtbaumeister in Essen und Landesplaner im Ruhrgebiet.
Von Petz, Ursula. Tübingen/Berlin (Wasmuth) 2016, 238 S. ISBN 978-3-8030-0790-2, € 24,80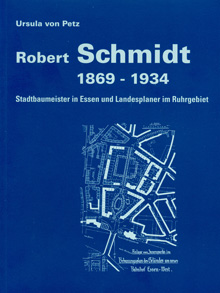 Etwa seit dem Ersten Weltkrieg, besonders aber seit den 1920er Jahren trat das Ruhrgebiet in eine neue Phase seiner räumlichen Entwicklung ein. Die exzessive, primär an den Standortforderungen der Montanindustrien orientierte Aneignung und zum Teil nachhaltige Zerstörung von Raum wurde konzeptionell in einen neuen Rahmen gestellt, um das einseitig strukturierte rheinisch-westfälischen Industriegebiet einer funktional, strukturell und ökologisch ausgeglichenen urbanen Entwicklung zuzuführen. Diese Jahre sind der Beginn der Landesplanung im Ruhrgebiet und Robert Schmidt ist sein erster Landesplaner, dessen Wirken bis heute nachhaltig ist. In der Annäherung an die Person Robert Schmidts stand die Verfasserin vor besonderen Herausforderungen, denn durch die Kriegszerstörungen des Gebäudes des Siedlungsverbandes wie auch des Privathauses gibt es weder einen beruflichen noch einen privaten Nachlass. Konsequenterweise beginnt die Autorin das erste Kapitel „Zur Person“ mit einer Sammlung zeitgenössischer in- und ausländischer Stellungsnahmen zu Robert Schmidt; es folgt eine formale Darstellung des Lebenslaufs. Das zweite Kapitel „Im Dienst der Stadt Essen“ stellt wesentliche Projekte vor, die Schmidt als Stadtbauinspektor und Beigeordneter begleitet oder initiiert hat; besondere Aufmerksamkeit erfahren zu Recht seine Denkschrift von 1912 und der Generalbau- und Wegeplan für das Industriegebiet. Das dritte Kapitel „Im Dienst des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk“ konzentriert sich auf Schmidt prägende und wegweisende Tätigkeit an der Spitze der neuen Planungsorganisation für das Ruhrgebiet. Das vierte Kapitel als Bibliographie der Veröffentlichungen Robert Schmidts und ein ausführlicher Quellenanhang beschließen das Buch. Der Autorin ist eine lesenswerte umfang- und facettenreiche Darstellung des ersten Landesplaners des Ruhrgebiets gelungen. Allerdings sind einige Abbildungen aus unverständlichen Gründen bis zur Unleserlichkeit verkleinert.
Etwa seit dem Ersten Weltkrieg, besonders aber seit den 1920er Jahren trat das Ruhrgebiet in eine neue Phase seiner räumlichen Entwicklung ein. Die exzessive, primär an den Standortforderungen der Montanindustrien orientierte Aneignung und zum Teil nachhaltige Zerstörung von Raum wurde konzeptionell in einen neuen Rahmen gestellt, um das einseitig strukturierte rheinisch-westfälischen Industriegebiet einer funktional, strukturell und ökologisch ausgeglichenen urbanen Entwicklung zuzuführen. Diese Jahre sind der Beginn der Landesplanung im Ruhrgebiet und Robert Schmidt ist sein erster Landesplaner, dessen Wirken bis heute nachhaltig ist. In der Annäherung an die Person Robert Schmidts stand die Verfasserin vor besonderen Herausforderungen, denn durch die Kriegszerstörungen des Gebäudes des Siedlungsverbandes wie auch des Privathauses gibt es weder einen beruflichen noch einen privaten Nachlass. Konsequenterweise beginnt die Autorin das erste Kapitel „Zur Person“ mit einer Sammlung zeitgenössischer in- und ausländischer Stellungsnahmen zu Robert Schmidt; es folgt eine formale Darstellung des Lebenslaufs. Das zweite Kapitel „Im Dienst der Stadt Essen“ stellt wesentliche Projekte vor, die Schmidt als Stadtbauinspektor und Beigeordneter begleitet oder initiiert hat; besondere Aufmerksamkeit erfahren zu Recht seine Denkschrift von 1912 und der Generalbau- und Wegeplan für das Industriegebiet. Das dritte Kapitel „Im Dienst des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk“ konzentriert sich auf Schmidt prägende und wegweisende Tätigkeit an der Spitze der neuen Planungsorganisation für das Ruhrgebiet. Das vierte Kapitel als Bibliographie der Veröffentlichungen Robert Schmidts und ein ausführlicher Quellenanhang beschließen das Buch. Der Autorin ist eine lesenswerte umfang- und facettenreiche Darstellung des ersten Landesplaners des Ruhrgebiets gelungen. Allerdings sind einige Abbildungen aus unverständlichen Gründen bis zur Unleserlichkeit verkleinert. Schlösser, Burgen und Ruinen. Historische Gemäuer und ihre Geschichte im und um das Ruhrgebiet.
Schlösser, Burgen und Ruinen. Historische Gemäuer und ihre Geschichte im und um das Ruhrgebiet.
Schürmann, Maren/Georg Howahl. Essen (Klartext) 2018, 160 S., ISBN 978-3-8375-1931-0, € 14,95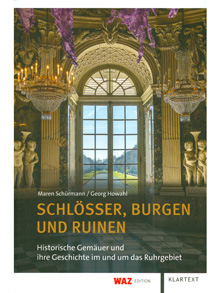 Diese Sammlung von 41 Reportagen über Schlösser und Burgen im Ruhrgebiet und am Niederrhein ist – wie schon einige Bücher der WAZ Edition zuvor – die Zusammenfassung von WAZ-Zeitungsartikeln. Dabei geht es nicht um tiefschürfende historische Darstellungen, sondern jede Lokalität wird hinsichtlich ihrer touristischen Erschließung und Attraktivität (Parkmöglichkeiten, Haltestelle, Begehbarkeit, touristische Besonderheiten, Gastronomie, Kontaktdaten) vorgestellt. Weiterhin werden die Objekte hinsichtlich ihrer geschichtlichen und/oder baulichen Besonderheit bzw. Ihrer Neunutzung charakterisiert, und dies fast immer mit Bezug auf Personen, die heute mit dem jeweiligen Objekt familiär, beruflich oder ehrenamtlich verbunden sind. Gut bebildert will dieses Buch Lust machen, die Relikte der vorindustriellen Geschichte der Region kennen zu lernen; als solches sollte es in die Hand genommen und genutzt werden.
Diese Sammlung von 41 Reportagen über Schlösser und Burgen im Ruhrgebiet und am Niederrhein ist – wie schon einige Bücher der WAZ Edition zuvor – die Zusammenfassung von WAZ-Zeitungsartikeln. Dabei geht es nicht um tiefschürfende historische Darstellungen, sondern jede Lokalität wird hinsichtlich ihrer touristischen Erschließung und Attraktivität (Parkmöglichkeiten, Haltestelle, Begehbarkeit, touristische Besonderheiten, Gastronomie, Kontaktdaten) vorgestellt. Weiterhin werden die Objekte hinsichtlich ihrer geschichtlichen und/oder baulichen Besonderheit bzw. Ihrer Neunutzung charakterisiert, und dies fast immer mit Bezug auf Personen, die heute mit dem jeweiligen Objekt familiär, beruflich oder ehrenamtlich verbunden sind. Gut bebildert will dieses Buch Lust machen, die Relikte der vorindustriellen Geschichte der Region kennen zu lernen; als solches sollte es in die Hand genommen und genutzt werden.Die Ruhmeshalle des Ruhrgebiets. 101 bemerkenswerte Biografien.
Die Ruhmeshalle des Ruhrgebiets. 101 bemerkenswerte Biografien.
Berke, Martin. Düsseldorf (Droste) 2016, 248 S., ISBN 978-3-7700-1597-9, € 16,99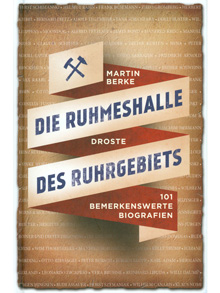 Die Geschichtsschreibung der industriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets hat verschiedene Bände mit den Biographien von Persönlichkeiten dieser Periode hervorgebracht, manche bedeutend, etliche mittlerweile vergessen, einige nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Diese Sammlung von Biographien ist anders. In 16 thematischen Kapiteln werden 101 Personen – von Friedrich Arnold Brockhaus bis Dolly Buster -, Figuren wie Alfred Tetzlaff oder Adolf Tegtmeier, Familien oder Gruppen – wie die Krupps oder der BVB porträtiert, wobei Charakteristisches Vorrang vor Biographischem hat. Manche der Darstellten sind irgendwo im Ruhrgebiet geboren, andere hier gestorben; etliche haben es nur gestreift, aber einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie erfanden die Dehnbundhose und den Oberinspektor Derrick, schenkten der Welt die Currywurst und 99 Luftballons oder brachten Ordnung in die deutsche Sprache. Martin Berke hat eine vergnügliche Sammlung von „Biographien“ zusammengestellt, wobei jeweils die überraschende Neuigkeit, die Kuriosität oder einfach unnützes Wissen ein wichtiges Auswahlkriterium gewesen zu sein scheint. Leicht bis schnodderig sind auch der Stil und das Layout des Buches, wenngleich man über einige gewollt witzige Zwischenüberschrift diskutieren kann.
Die Geschichtsschreibung der industriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets hat verschiedene Bände mit den Biographien von Persönlichkeiten dieser Periode hervorgebracht, manche bedeutend, etliche mittlerweile vergessen, einige nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Diese Sammlung von Biographien ist anders. In 16 thematischen Kapiteln werden 101 Personen – von Friedrich Arnold Brockhaus bis Dolly Buster -, Figuren wie Alfred Tetzlaff oder Adolf Tegtmeier, Familien oder Gruppen – wie die Krupps oder der BVB porträtiert, wobei Charakteristisches Vorrang vor Biographischem hat. Manche der Darstellten sind irgendwo im Ruhrgebiet geboren, andere hier gestorben; etliche haben es nur gestreift, aber einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie erfanden die Dehnbundhose und den Oberinspektor Derrick, schenkten der Welt die Currywurst und 99 Luftballons oder brachten Ordnung in die deutsche Sprache. Martin Berke hat eine vergnügliche Sammlung von „Biographien“ zusammengestellt, wobei jeweils die überraschende Neuigkeit, die Kuriosität oder einfach unnützes Wissen ein wichtiges Auswahlkriterium gewesen zu sein scheint. Leicht bis schnodderig sind auch der Stil und das Layout des Buches, wenngleich man über einige gewollt witzige Zwischenüberschrift diskutieren kann. 111 Orte im Ruhrgebiet, die man gesehen haben muss. Band 1 und 2
111 Orte im Ruhrgebiet, die man gesehen haben muss. Band und 2
Fabian Pasalk. Neuauflage, Köln (Emons-Verlag) 2017, 240 S., ISBN 978-3-89705-814-9, € 16,95 Fabian Pasalk Band 2, Neuauflage, Köln (Emons-Verlag) 2016, 240 S., ISBN 978-3-95451-223-2, € 16,95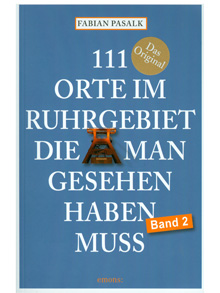 Wenn Sie nicht (nur) Industriekultur besuchen wollen, wenn Sie schon dem Rat von Historikern und Archäologen gefolgt sind, dass es im Ruhrgebiet auch Orte der vorindustriellen Geschichte gibt, und keine Schlösser und Burgen mehr besuchen wollen, wenn sie auch nicht unbedingt nur nach Standorten von Merkwürdigkeiten suchen, dann folgen Sie doch diesen beiden Büchern und ihren Vorschlägen aus einem breiten Spektrum von Ruhrgebietsnatur, Alltagsleben, Geschichte, Technik und Kunst und finden Sie Spektakuläres aus der zweiten Reihe, Überraschendes, Liebenswertes oder Orte, von deren Existenz Sie wussten, an denen Sie aber noch nie waren (hier einige Beispiele von 222): auf dem Europaplatz von Castrop-Rauxel, in der Dortmunder Schwebebahn, beim Hebeturm des Rheintrajekts in Homberg, an der Halde Zollverein I/II, in den Bergsenkungen im Königreich Beisen, auf der Korte-Klippe, in der Schalker Glückauf-Kampfbahn, in der Heilig-Kreuz-Kirche (Gelsenkirchen-Ückendorf) am Solarbunker (Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen), im Hagener Hohenhof, an den Hügelhäusern von Marl-Drewer, in der Mülheimer Straße der Millionäre, an der Fossa Eugeniana (Rheinberg), im chinesischen Garten (Bochum-Querenburg), im Currywurst-drive in von Dorsten, im Magnetmuseum (Dortmund-Aplerbeck), in der Hochzeitsmeile von Marxloh, im Bergmannsdom (Essen-Katernberg), zwischen den Baumskulpturen an Schloss Berge (Gelsenkirchen-Buer), auf der Fleuthebrücke (Gelsenkirchen-Resser Mark) oder im Gethmann’schen Garten in Hattingen. Für alle 222 Lokalitäten werden die Anreisewege mit dem eigenen Pkw und dem ÖPNV angegeben sowie Tipps über Interessantes in der Umgebung; hinzu tritt in jedem der uneingeschränkt empfehlenswerten Bände eine Übersichtskarte.
Wenn Sie nicht (nur) Industriekultur besuchen wollen, wenn Sie schon dem Rat von Historikern und Archäologen gefolgt sind, dass es im Ruhrgebiet auch Orte der vorindustriellen Geschichte gibt, und keine Schlösser und Burgen mehr besuchen wollen, wenn sie auch nicht unbedingt nur nach Standorten von Merkwürdigkeiten suchen, dann folgen Sie doch diesen beiden Büchern und ihren Vorschlägen aus einem breiten Spektrum von Ruhrgebietsnatur, Alltagsleben, Geschichte, Technik und Kunst und finden Sie Spektakuläres aus der zweiten Reihe, Überraschendes, Liebenswertes oder Orte, von deren Existenz Sie wussten, an denen Sie aber noch nie waren (hier einige Beispiele von 222): auf dem Europaplatz von Castrop-Rauxel, in der Dortmunder Schwebebahn, beim Hebeturm des Rheintrajekts in Homberg, an der Halde Zollverein I/II, in den Bergsenkungen im Königreich Beisen, auf der Korte-Klippe, in der Schalker Glückauf-Kampfbahn, in der Heilig-Kreuz-Kirche (Gelsenkirchen-Ückendorf) am Solarbunker (Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen), im Hagener Hohenhof, an den Hügelhäusern von Marl-Drewer, in der Mülheimer Straße der Millionäre, an der Fossa Eugeniana (Rheinberg), im chinesischen Garten (Bochum-Querenburg), im Currywurst-drive in von Dorsten, im Magnetmuseum (Dortmund-Aplerbeck), in der Hochzeitsmeile von Marxloh, im Bergmannsdom (Essen-Katernberg), zwischen den Baumskulpturen an Schloss Berge (Gelsenkirchen-Buer), auf der Fleuthebrücke (Gelsenkirchen-Resser Mark) oder im Gethmann’schen Garten in Hattingen. Für alle 222 Lokalitäten werden die Anreisewege mit dem eigenen Pkw und dem ÖPNV angegeben sowie Tipps über Interessantes in der Umgebung; hinzu tritt in jedem der uneingeschränkt empfehlenswerten Bände eine Übersichtskarte. Raumstrategien Ruhr 2035+. Konzepte zur Entwicklung der Agglomeration Ruhr.
Raumstrategien Ruhr 2035+. Konzepte zur Entwicklung der Agglomeration Ruhr.
Jan Polivka/Christa Reicher/Christoph Zöpel (Hg.) Dortmund (Verlag Kettler) 2017, 296 S., ISBN 978-3-86206- 678-0, € 39,90 Zu diesem gewichtigen Buch gibt es einige Vorläufer, der wohl wichtigste ist der 2011 erschienene Analyseband „Schichten einer Region – Kartenstücke zur räumlichen Struktur des Ruhrgebiets“. Der Analyse folgt mit diesem Buch der Planungs- oder Perspektiventeil. Der aktuellen Planungsdiskussion entsprechend gliedert sich der Band nach einer Einleitung in die Themenkapitel „Wohnkultur und Siedlungsstruktur“, “Flächenbedarf der Wirtschaft“, „Netze für die urbane Mobilität“, „Landschaft und Infrastruktur“, „Struktur der Energieversorgung“, „Steigerung der Lebensqualität“ und „Bildung und Integration“, alle ausgestattet mit aussagekräftigen Karten und Graphiken. Darauf aufbauend zeigen die drei Herausgeber 14 komplementäre Zukunftswege für die Agglomeration Ruhr auf, wobei sie von der industriehistorisch bedingten „ruhrbanen Kulturlandschaft“ ausgehen und zur Realisierung der verschiedenen Sachziele eine „institutionelle Existenz und Verfasstheit“ für die Region fordern, um die letztendlichen Ziele „Integration“, „Innovation“ und „Internationalisierung“ zu erreichen. In Weiterführung der regionalen Analyse von 2011 wird mit diesem Buch ein modernes integratives Planungskonzept für das Ruhrgebiet vorgelegt.Essener Straßen. Essener Köpfe.
Essener Straßen.
Stadt Essen/Historischer Verein für Stadt und Stift Essen e.V. Essen (Klartext-Verlag) 2015, 387 S., ISBN 978-3-8375-0848-2, € 19,95Essener Köpfe.
Stadt Essen/Historischer Verein für Stadt und Stift Essen e.V. Essen (Klartext-Verlag) 2015, 400 S., ISBN 978-3-8375-0849-9, € 19,95 Dies ist keine Buchrezension, sondern eine wichtige, wenngleich etwas verspätete Buchanzeige. 1979 und 1985 erschienen erstmals „Essener Straßen“ und „Essener Köpfe“, herausgegeben von Erwin Dickhoff. Sie wurden zu lokalhistorischen Standardwerken; schon Ende des vergangenen Jahrhunderts waren aktuelle Neuauflagen Desiderate. Die Stadt Essen und der Historische Verein besorgten diese nun 2015. „Essener Straßen“ ist dabei um 205, seit 1979 hinzugekommene Straßen gewachsen, die „Essener Köpfe“ haben sich auf der Basis von Vorschlägen aus der Öffentlichkeit um 282 vermehrt. Damit liegen allen lokal Forschenden und Interessierten zwei wichtige qualitätsvolle Nachschlagwerke in aktueller Form vor.Geschichten einer Region. AgentInnen des Wandels für ein nachhaltiges Ruhrgebiet.
Geschichten einer Region. AgentInnen des Wandels für ein nachhaltiges Ruhrgebiet.
Claus Leggewie/Christa Reicher/Lea Schmitt (Hg.) Dortmund (Verlag Kettler) 2016, 335 S., ISBN 978-3-86206-607-0, € 29,90 Die Umsetzung des Weltklimaabkommens ist nicht nur durch eine „einfache“ Energiewende zu erreichen. Um ökologisch, sozial und politisch nachhaltige Strukturen und Handlungsroutinen zu erreichen, sind umfassende Umgestaltungen, vor allem in den Bereichen Mobilität, Ressourcen- und Energieverbrauch, Landwirtschaft und Stadtentwicklung notwendig. Für den Erfolg der Umsetzung sind die Berücksichtigung der regionalen/lokalen Eigenart, des lokalen nachhaltigen Umgangs mit Umweltproblemen und die spezifische Form der Teilhabe entscheidend. Vor diesem Hintergrund gliedert sich die Veröffentlichung in die Abschnitte „Energie & Ressourceneffizienz“, „Erneuerbare Energien“, „Mobilität & Verkehr“, „Städtebau & Stadtplanung“ und „Bildung & Information“. In jedem dieser Felder des Wandels werden bereits in der Region vorhandene Aktionen und Organisationen vorgestellt; ergänzt werden diese durch informative Karten und Graphiken. Auf diese Weise wird ein interessanter Überblick über die bereits vorhandenen, an den eingangs aufgezeichneten Zielen orientierte Grassroot-Aktivitäten gegeben. Die Antwort, auf welche Weise und mit welchem Ziel es davon ausgehend zu einem umfassen, komplexen regionalen Verbund kommen soll, die Eigenart, Nachhaltigkeit und Teilhabe berücksichtigt, bleibt das Schlusskapitel schuldig. Hier wird lediglich auf die rechtlichen Möglichkeiten eines demokratisch verfassten Regionalverbandes hingewiesen und gefordert, die Unternutzung ihrer Polyzentralität, d.h. das Kirchturmdenken zu überwinden.Energiewenden – Wendezeiten.
Energiewenden – Wendezeiten.
LVR-Industriemuseum/Walter Hauser (Hg.) Münster (Aschendorff) 2017. 186 S., ISBN 978-3-402-13258-6, € 17,90 Passend zur Stilllegung von Prosper II und damit dem Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet sowie mit der gleichzeitigen Schließung des Bergwerks Ibbenbüren und damit dem Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland zeigt das LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg vom 20.10.2017 bis zum 28.10.2018 unter dem obigen Titel eine Ausstellung; der vorliegende Band ist der Ausstellungskatalog. Zunächst werden die verschiedenen primären und sekundären Energieträger in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und in ihrer prägenden Wirkung auf die Kulturlandschaft im Zuge der verschiedenen energetischen Transformationen dargestellt. Dem folgt eine eingehende Betrachtung der Energielandschaft NRW, bevor über eine Ausweitung auf die globale Dimension die Notwendigkeiten und Formen der Energiewende analysiert werden, die ohne Digitalisierung und dezentrale Konzepte nicht möglich ist. Smarte und dezentrale Visionen eröffnen neue Fragestellungen und Visionen; in den hoch entwickelten Ländern mag der Prosumer, der Energie produziert wie verbraucht, eine Realität werden, wie die Mehrzahl der Menschheit jedoch an eine nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung angebunden werden kann, gehört noch zu den zu lösenden Problemen. Eingestreut in dieses Konzept sind Interviews und Gastbeiträge zu verschiedenen aktuellen Fragestellungen der Energiewende. Ausstellungen und Bücher sind grundsätzlich unterschiedliche Formen der Informationsvermittlung; in diesem Fall bietet sich die Chance, sie ergänzend zu benutzen. Wer es in die Ausstellung nicht schafft, an diesem wichtigen Thema jedoch interessiert ist, greife zu dieser gleichermaßen fundiert wie ansprechend gemachten Veröffentlichung.Vergessene Orte im Ruhrgebiet/Lost Places in the Ruhr Area.
Vergessene Orte im Ruhrgebiet/Lost Places in the Ruhr Area.
Peter Untermaierhofer Halle (Mitteldeutscher Verlag) 2013, 160 S., ISBN 978-3-95462-105-7, € 24,95 Dieses Buch ist ein schöner Bildband über alte Industrieanlagen im Ruhrgebiet im besenreinen Schwebezustand zwischen aufgegebener alter Nutzung und (noch nicht gefundener) neuer Nutzung. Der Titel ist ein geschmäcklerischer Unsinn; denn die vorgestellten Orte sind keineswegs unvergessen, sondern in vielen Fällen feste Bestandteile der regionalen Industriekultur. Dies wird auch in einigen der beigegebenen Texte von Thomas Parent deutlich. In diesem Zusammenhang wäre es auch hilfreich gewesen, wären den Fotos die Aufnahmedaten beigegeben worden. Aber hier geht es weniger um textliche Information als vielmehr um das besondere Bild. Für diejenigen also, die nicht auf der Suche nach vordergründigem Hochglanz sind, sondern hinsichtlich Motivwahl, Stimmung und Farbgebung die etwas anderen Fotos von ausrangierten Industrieanlagen suchen, ist dieses Buch eine gute Wahl.Industrie und Fotografie. Der „Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation“, 1854-1926.
Industrie und Fotografie. Der „Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation“, 1854-1926.
Ralf Stremmel Münster (Aschendorff Verlag) 2017, 248 S., ISBN 978-3-402-13213-5, € 29,95 Der Bochumer Verein gehörte einst zu den größten montanindustriellen Unternehmen Deutschlands. Nahezu von Beginn an betrieb er eine ausgeprägte und vielseitige Werksfotografie. 125000 Aufnahmen sind im Historischen Archiv Hügel überliefert. Aus diesen wurden 236 Motive aus der Zeit von der Gründung bis zur Eingliederung in die Vereinigten Stahlwerke ausgewählt. Der Stil des Buches kopiert alte Firmenchroniken und umfasst textlich und fotografisch verschiedenste Aktivitätsbereiche des Unternehmens – Entwicklungsgeschichte, Beschäftigte, soziale Einrichtungen, Sicherheit und Arbeitsschutz, Produktion und Produkte (Vom Eisen über Stahl zum Endprodukt; Glocken, Maschinen und Kanonen; Fahrzeug und Fahrzeugteile; Zechen und andere Tochterbetriebe), Hilfs- und Nebenbetriebe, Wissensbetriebe, Anlagen außerhalb der Werkstore. Der Reiz des Buches liegt zum einen in der umfassenden Fotodokumentation des BV in der angegebenen Phase, zum anderen in der Tatsache, dass die Mehrzahl der Fotos erstmalig veröffentlicht werden.Mythos Ruhrbistum. Identitätsfindung, Innovation und Erstarrung in der Diözese Essen von 1958-1970.
Mythos Ruhrbistum. Identitätsfindung, Innovation und Erstarrung in der Diözese Essen von 1958-1970.
Franziskus Siepmann Essen (Klartext) 2017, 655 S., ISBN 978-3-8375-1454-4, € 39,95 „Das Bistum ist errichtet. Ich bin jetzt hier gleichsam vor Ort gegangen. In Gottes Namen wollen wir die erste Schicht verfahren.“ (Bischof Franz Hengsbach, 1958) – „Ich bin nicht mehr der Bischof der Bergarbeiter“ (Bischof Franz-Josef Overbeck, 2013). Diese beiden Zitate markieren den Beginn und den bisherigen Endpunkt des Bistums Essen. Es wurde gegründet als Arbeiterbistum, in dem die Arbeiterseelsorge grundlegend werden sollte. Dieses Ziel bestimmte die Wahl des ersten Bischofs ebenso wie die Aufbruchsstimmung des ersten Jahrzehnts, die sich in Kirchenneubauten und Pfarreigründungen manifestierte. Ein engmaschiges Netz der kirchlichen Organisation sollte eine – heute als antiquiert angesehene – paternalistische Arbeiterseelsorge ermöglichen. Bereits im Gründungsjahr 1958 begannen jedoch die sozio-ökonomischen Bedingungen, in die das Bistum hineingegründet worden war, wegzubröckeln. Je weiter der sogenannte Strukturwandel voranschritt, wurde das Ruhrbistum als katholisch-organisatorisches Gegenstück zum Ruhrgebiet ein Mythos. Als Anwalt der Arbeiter begleitete der im Grunde konservative erste Bischof Franz Hengsbach als Mittler zwischen den sozialpolitischen Fronten diesen Wandlungsprozess. Die tiefgreifenden kulturellen, gesellschaftlichen und – im Gefolge des II. Vatikanums – kirchlichen Umbrüche seit den 1960er Jahren vermochte das Bistum jedoch nur zögerlich durch Antworten und neue Seelsorgekonzepte zu begleiten. Interne Auseinandersetzungen führten zu einer gewissen Paralysierung. Die zunehmende Entfremdung der Katholiken von ihrer Kirche und der Rückgang der Priesterberufungen macht das eingangs geschaffene enge pastorale Netzwerk zunehmend überflüssig und bis in die Gegenwart auch nicht mehr finanzierbar. Die besondere Geschichte dieses Bistums scheint noch immer in die Gegenwart durch, seine Positionierung in einem gewandelten Ruhrgebiet der Zukunft ist aber noch zu finden. Ein in jeder Hinsicht gewichtiges und empfehlenswertes Buch.Gartenstädte und Zechenkolonien. Beispiele im Ruhrgebiet und in Nordwestdeutschland.
Gartenstädte und Zechenkolonien. Beispiele im Ruhrgebiet und in Nordwestdeutschland.
Gerhard Kaldewei Münster (Aschendorff) 2018, 199 S., ISBN 978-3-402-13275-3, € 39,90 Dieses Buch, verfasst vom ehemaligen Leiter des Nordwestdeutschen Museums für IndustrieKultur in Delmenhorst, ist ein schwieriges. Es ist der Versuch, industrielles Wohnen im Ruhrgebiet und, mit dem Beispiel Delmenhorst, im westfälischen Textilgebiet in den historischen Rahmen sich wandelnder gesellschaftlicher Bedingungen und sich entwickelnder architektonisch-städtebaulicher Konzepte zu analysieren und zu bewerten. Dies geschieht in den drei Kapiteln „Von der Lebensform zur Gartenstadtbewegung“, „Werkbund, Heimatbewegung, Zechenkolonien“ und „Industriekultur“; eingestreut in diese Kapitel sind Exkurse, in denen fünf Siedlungen in ihrer historischen Entwicklung präsentiert werden. Die Arbeit basiert auf einem recht umfangreichen Literaturverzeichnis, mit dem Schwerpunkt vor 2000; von den eigenen (nicht historischen!) Fotos, die die aktuelle Struktur der Siedlungen verdeutlichen soll, sind nur etwa fünf jünger als 1990. Zusätzlich zu dieser „angestaubten“ Anmutung wird die Intention des Autors nicht klar, zum einen weil es weder eine entsprechende Einführung, noch ein wertendes Schlusskapitel gibt, zum anderen weil er sich, außer bei den Sachdarstellungen der Exkurse, fast gänzlich hinter einer hohen Dichte von Zitaten versteckt. Damit gelingt es, eine weitgehend sachgerechte Kompilation zu erstellen, wenngleich die Auswahl der Siedlungen die Tendenzen vorgibt, zugleich aber auch wieder die sattsam bekannten Fehler produziert; Eisenheim entsteht in der „Ödnis“ des späteren „nordamerikanischen“ Oberhausen, Osthaus‘ Hohenhagen ist zu Recht eine herausragende Antithese, die Delmenhorster Nordwolle-Kolonie steht für paternalistische Gesinnungen einiger Industrieller, für die Überhöhung der Gartenstadtidee wird einmal mehr fälschlicherweise, weil von Metzendorf ausdrücklich abgelehnt, die Margarethenhöhe vereinnahmt; als Beispiel für die hundert „Normalfälle“ steht die Kolonie Maximilian in Hamm. Alles, was in dieser Kompilation abgehandelt wird, ist bereits bekannt und häufig besser dargestellt worden. Im letzten Kapitel macht sich zudem die Außensicht des Autors bemerkbar; diese ist nicht – wie sie es sein könnte inspirierend, sondern führt zu Fehleinschätzungen, z.B. über die IBA, oder – wieder versteckt hinter ausgewählten Zitaten gar zu Häme, z.B. über die Kulturhauptstadt und über den Identität stiftenden und ökonomischen Wert der Industriekultur. Hier hätte der Autor besser eine differenzierte Diskussion über das labile Gleichgewicht zwischen der Identifikation mit und einer kritischen Distanz zur Region und ihrem industriekulturellen Erbe führen sollen; genügend Quellen für Zitate hätte er dazu gefunden.Architektur der Essener Plätze.
Architektur der Essener Plätze.
Berger Bergmann/Peter Brdenk (Hg.) Architektur der Essener Plätze. Essen (Klartext) 2017, 195 S., ISBN 978-3-8375-1710-1, € 17,95 Nach ihren intensiven Präsentationen der Architektur in Essen 1900-1960 und 1960-2013 legen die beiden Autoren als dritten Band eine Analyse der Essener Plätze und Parks vor. Allgemeine Entwicklungstrends an Essener Beispielen verdeutlichend, werden in einleitenden Essays Plätze in ihrer historischen Entwicklung dargestellt, der Aufenthalt im Freien betrachtet, Parks, Plätze und Parkplätze gegen einander gestellt und die Wirkung von Freiräumen für die Stadtgestalt untersucht. Danach folgt die Vorstellung (Struktur, Geschichte, Veränderung) von 50 Plätzen und 12 Parks. Die formale Beschränkung auf drei Fotos und ein halbe Seite Text darf durchaus als ein formales Korsett angesehen werden, wird sie doch der Komplexität mancher Plätze und Parks nicht gerecht. Auch standen den Autoren sicherlich mehr Quellen zur Verfügung, die sie dem Leser hätten angeben können, als die wenigen Literaturtipps. Davon abgesehen, ist auch der dritte Band dieser Essener Architekturreihe ein fundiertes und empfehlenswertes Buch.Hundert sieben Sachen. Bochumer Geschichte in Objekten und Archivalien.
Hundert sieben Sachen. Bochumer Geschichte in Objekten und Archivalien.
Ingrid Wölk (Hg.) Essen (Klartext) 2017, 672 S., ISBN 978-3-8375-1869-6, € 29,95 Basierend auf den Ideen des Kulturwissenschaftlers Gottfried Korff, gab Ingrid Wölk vom Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte im Jahre 2007 den Band „Sieben und neunzig Sachen. Sammeln – bewahren – zeigen. Bochum 1910-2007“ heraus; nun liegt der Folgeband vor, der derselben Methodik folgt. Es sind nicht hundert Siebensachen, sondern hundertsieben Sachen – Objekte und Archivalien -, die von den Autoren zum Leben erweckt werden. Zeitlich zwischen bronzezeitlichen Scherben und dem Holzmodell des Musikzentrums gehören dazu – für diese Zeilen zufällig aufgeschlagen das Langendreerer Bauerschaftsbuch, eine silberne Deckeldose des Gold- und Silberschmieds Gerhard Wilhelm Strunck, die Akte über die Lustmordserie im Landkreis Bochum in den 1880er Jahren, ein Foto mit belgischen Zwangsarbeitern im Ersten Weltkrieg, ein Badeanzug im Bochumer Blau als Erinnerung an das Stadtbad Bochum, ein Plakat des Kemnader Festivals von 1974 oder eine Trompete aus Sheffield zur Erinnerung an die 35-jährige Städtepartnerschaft. Die Texte sind von unterschiedlicher Qualität, insgesamt eröffnet sich jedoch ein Kaleidoskop von Facetten, aber auch manche lange Entwicklungslinie der Stadt-, Sozial- und Kulturgeschichte Bochums.Echt jetzt?! Die wirklich wahren Geheimnisse des Ruhrgebiets.
Echt jetzt?! Die wirklich wahren Geheimnisse des Ruhrgebiets.
Wolfgang Berke Essen (Klartext) 2018, 144 S., ISBN 978-3-8375-1900-6, € 14,95 Jedem, der landeskundlich arbeitet, kommen Geschichten, Anekdoten, Tatsachen und Gerüchte unter, die nicht in das gerade untersuchte Thema passen. Ähnliches muss auch Wolfgang Berke widerfahren sein. Die Informationsschnipsel, die manchmal tiefere Einsichten oder Gefühle vermitteln, manchmal witzig sind, häufig jedoch auch nur unnützes Wissen darstellen, hat er in diesem kleinen Band – unter mehr oder weniger passenden Kapitelüberschriften – zusammengestellt. Wir erfahren, dass es die erste Einkaufsmall des Ruhrgebiets in Wanne-Eickel gab, dass Gerhard Richter in der Duisburger U-Bahn gearbeitet hat, dass „Fanta“ in Essen erfunden wurde, dass der Mittelpunkt des Ruhrgebiets in Wanne-Eickel, heute Herne 2, liegt, dass es ein gelbes Haus im blau-weißen Schalke gibt und einen schwarzgelben Kreißsaal in Dortmund … insgesamt „einsichtig“, witzig, manchmal unnütz die wirklichen wahren Geheimnisse des Ruhrgebiets, häufig mit einem Augenzwinkern.Wege zur Metropole – Heimat im Wandel.
Wege zur Metropole – Heimat im Wandel.
Joachim Scharioth/Jörg-Peter Schräpler (Hg.) Essen (Klartext) 2017, 255 S., ISBN 978-3-8375-1794-1 Vom 26. Bis 29. April 1972 fotografierten sechs Studierende der Fachhochschule Dortmund rund 785 zufällig ausgewählte Standorte im Ruhrgebiet, die unter dem Titel „Soziologie in Bildern“ Eingang in die Ausstellung „Szene Rhein-Ruhr ´72“ des Folkwang-Museums fand. Zwischen 2012 und 2016 wurden die damaligen Standorte – manchmal unter technischen Schwierigkeiten und mit Korrekturen erneut besucht und fotografiert. Die so entstandenen 400 Fotopaare waren 2017 Teil der dreimonatigen Ausstellung „Wege zur Metropole Ruhr – Heimat im Wandel“ im Bochumer Haus Weitmar. Die Fotopaare werden im vorliegenden Band entlang der Dimensionen Wirtschaft, Bildung, Freiräume, Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr, Landmarken & Kunst und Spurensuche interpretiert. Ergänzt werden sie durch Luftbilder, die den Orientierungs- und Interpretationsrahmen erweitern, durch Interviews, durch eine kleinräumige statistische Langzeituntersuchung zur Bildungssegregation und zum Bildungspotential sowie durch Texte, die zum Teil aus der Vortragsreihe erwachsen sind, die im Gefolge der Ausstellung von 2017 in Haus Weitmar stattfand; thematisch gehören dazu Betrachtungen zur Veränderung von Heimat sowie die Entwicklung von Leitideen. Den Anhang bildet eine detaillierte Interpretation aller fotographischen Aufnahmen. Insgesamt ist das Buch eine facettenreiche und methodisch höchst interessante Analyse des räumlichen und strukturellen Wandels im Ruhrgebiet. Der Titel, der aktuelle Reizworte aufnimmt, wird ihr allerdings nicht gerecht. Zudem wird ein Wandel von „Heimat“ nicht hinreichend diskutiert und die Betrachtungen zur Metropole verlieren sich in bekannten Befunden und bleiben hinter dem aktuellen Diskussionsstand weit zurück.Alte Synagoge Essen – Haus Jüdischer Kultur.
Alte Synagoge Essen – Haus Jüdischer Kultur.
Stadt Essen (Hg.) Die Dauerausstellung. Essen (Klartext-Verlag) 2016, 208 S., ISBN 978-3-8375-1450-6, € 19,95 Essens alte Synagoge gehört architektonisch zu den bedeutendsten Synagogen Deutschlands und machte seinen Erbauer, Edmund Körner, zu einem bekannten Architekten. In der Nazizeit im Innern stark zerstört, wurde sie nach dem Krieg durch Umbauten 1959/60 zunächst zum Haus Industrieform, ab 1980 und mit den teilweise rekonstruierenden Umbauten von 1986 zu einer Gedenk- und Dokumentationsstätte und, seit 2008-10 mit neuem Konzept, zum Haus jüdischer Kultur. Inhaltlich gliedert sich das Buch in die Darstellung des Nutzungswandels in der alten Synagoge vor dem Hintergrund der gewandelten Erinnerungskultur in Essen und Deutschland, in die architektonisch-baugeschichtliche Analyse des historischen Bauwerks und seiner Umbauten und baulichen Rekonstruktionen sowie in die Erläuterung des gegenwärtigen Ausstellungskonzepts und der gezeigten Exponate. Ein lesenswertes Buch über den Wandel eines der markanten Gebäude Essens.Burgenland Essen. Burgen, Schlösser und feste Häuser in Essen.
Burgenland Essen. Burgen, Schlösser und feste Häuser in Essen.
Detlef Hopp/Bianca Khil/Elke Schneider Essen (Klartext-Verlag) 2017, 131 S., ISBN 978-3-8375-1739-2, € 14,95 Burgen, Schlösser und feste Häuser gehören zum bestimmenden Inventar der vorindustriellen Kulturlandschaft auf dem Gebiet der heutigen Stadt Essen; etwa 30 Anlagen – von Schloss Borbeck bis zur Motte „Hügel“ sind in unterschiedlichen Erhaltungszuständen noch vorhanden. Was für einen prächtigen, großformatigen Bildband hätte man aus diesem Thema machen können! Wahrscheinlich hätte man diesen aber nach (einmaliger) Durchsicht als erledigt beiseitegelegt. Das Format dieses Buches ist deutlich kleiner, sein Inhalt aber erheblich gewichtiger. Stadtarchäologe Detlef Hopp und seine beiden Co-Autorinnen erschließen kleinteilig jedes der Objekte mittels Karten, schriftlichen Quellen, Bodenfotos, Luftbildern und eigenen Grabungsergebnissen und zeigen in hochinformativen Texten, was noch ist, was sich geändert hat, was nicht mehr vorhanden ist. Dieses sehr empfehlenswerte Buch wird man nicht so schnell beiseitelegen.Soziale Stadt Gelsenkirchen. 20 Jahre Modellstadt der integrierten Stadterneuerung.
Soziale Stadt Gelsenkirchen. 20 Jahre Modellstadt der integrierten Stadterneuerung.
Janine Feldmann/Detlef Kurth/Stefan Rommelfanger Schriftenreihe des Instituts für Stadtgeschichte – Beiträge, Bd. 18, Essen (Klartext) 2015, 146 S., ISBN 978-3-8375-1441-4, € 12,95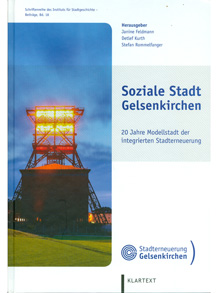 Gelsenkirchen gilt innerhalb des Ruhrgebiets nach oder neben dem nördlichen Duisburg als die Stadt mit den größten sozialen und ökonomischen Problemen. Mag diese Aussage auch unspezifisch sein, so hat sie doch dazu geführt, dass Gelsenkirchen in den letzten Jahrzehnten immer eine erste Adresse für die Implementierung von Landes- und Bundesprogrammen zur Beförderung des postindustriellen Strukturwandels bzw. zur Linderung der Folgen der De-industrialisierung war. Deren Anwendung hat gezeigt, dass die sozio-ökonomischen Probleme weit komplexer waren/sind als die eingangs angesprochene Imagezuweisung es vermuten lässt, dass komplexe Probleme komplexe und umfassende Lösungsansätze erforder(te)n, die zum Teil erst hier erarbeitet und erprobt wurden, so dass Gelsenkirchen in den letzten Jahrzehnten zur Modellstadt für die weitgehend erfolgreiche Anwendung derartiger Programme wurde und sich in der Organisationsstruktur und beim Personal der Stadtverwaltung eine anderswo nicht erreichte Expertise herausbilden konnte. Die vorliegende Veröffentlichung zieht Bilanz hinsichtlich der gesamtstädtischen Perspektiven, der Instrumente der Umsetzung, der Verbindung der gesamtstädtischen mit den lokalen Zielen und hinsichtlich der verschiedenen räumlichen Schwerpunkte und Modellprojekte. Diese Bilanz zeigt, dass Gelsenkirchen nicht nur wegen seiner Probleme, sondern auch durch die Erfahrungen mit kollektiven Lernprozessen, den Formen des Stadtteilmanagements, den Prozessen zur Verstetigung von Prozessen und der Erarbeitung neuer planerischer Selbstverständlichkeiten zur Stadt mit der regional, vielleicht auch national größten Expertise hinsichtlich der zukunftsweisenden integrierten Stadterneuerung gewachsen ist.
Gelsenkirchen gilt innerhalb des Ruhrgebiets nach oder neben dem nördlichen Duisburg als die Stadt mit den größten sozialen und ökonomischen Problemen. Mag diese Aussage auch unspezifisch sein, so hat sie doch dazu geführt, dass Gelsenkirchen in den letzten Jahrzehnten immer eine erste Adresse für die Implementierung von Landes- und Bundesprogrammen zur Beförderung des postindustriellen Strukturwandels bzw. zur Linderung der Folgen der De-industrialisierung war. Deren Anwendung hat gezeigt, dass die sozio-ökonomischen Probleme weit komplexer waren/sind als die eingangs angesprochene Imagezuweisung es vermuten lässt, dass komplexe Probleme komplexe und umfassende Lösungsansätze erforder(te)n, die zum Teil erst hier erarbeitet und erprobt wurden, so dass Gelsenkirchen in den letzten Jahrzehnten zur Modellstadt für die weitgehend erfolgreiche Anwendung derartiger Programme wurde und sich in der Organisationsstruktur und beim Personal der Stadtverwaltung eine anderswo nicht erreichte Expertise herausbilden konnte. Die vorliegende Veröffentlichung zieht Bilanz hinsichtlich der gesamtstädtischen Perspektiven, der Instrumente der Umsetzung, der Verbindung der gesamtstädtischen mit den lokalen Zielen und hinsichtlich der verschiedenen räumlichen Schwerpunkte und Modellprojekte. Diese Bilanz zeigt, dass Gelsenkirchen nicht nur wegen seiner Probleme, sondern auch durch die Erfahrungen mit kollektiven Lernprozessen, den Formen des Stadtteilmanagements, den Prozessen zur Verstetigung von Prozessen und der Erarbeitung neuer planerischer Selbstverständlichkeiten zur Stadt mit der regional, vielleicht auch national größten Expertise hinsichtlich der zukunftsweisenden integrierten Stadterneuerung gewachsen ist. Wo es im Ruhrgebiet am schönsten ist
Wo es im Ruhrgebiet am schönsten ist
Rolf Kiesendahl Hamburg (Ellert und Richter Verlag) 2015, 176 S., ISBN 978-3-8319-0622-2, € 9,95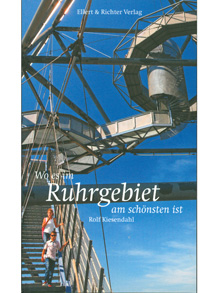 Diese Veröffentlichung hinterlässt einen bestenfalls zwiespältigen Eindruck. Als Reiseführer (?), der laut Vorwort des Autors einladen soll, die Kontraste des Ruhrgebiets kennen zu lernen, gehört sie zu der in den letzten Jahren wuchernden Gruppe von „Faszination Ruhrgebiet“- Bild- und Textbänden, die mit selten neuen Erkenntnissen und Bildern an immer dieselben Stätten des Ruhrgebiets heranführen, die man unbedingt vor dem eigenen Ableben noch gesehen haben muss. In dem vorliegenden Band werden 44 Standorte in Kurztexten beschrieben, von denen lediglich etwa ein Viertel nicht zum Standardprogramm eines Ruhrgebietsreiseführers gehört (z.B. Unperfekthaus in Essen, Berne-Park in Bottrop, Hochzeitsmeile in Marxloh). Ein Infokasten gibt für jedes Objekt eine Anfahrtsbeschreibung oder eine Post- oder Web-Adresse an; hinzu tritt eine kartographisch gänzlich unzureichende Übersichtskarte, die jedoch nur die administrativen Grenzen des Ruhrgebiets, aber keines der angesprochenen Objekte verzeichnet. Man kann die Veröffentlichung vielleicht auch als eine Sammlung von subjektiven Kurzessays des Autors ansehen, mit der das Interesse von externen Besuchern geweckt werden soll, die jedoch nicht frei von Ungenauigkeiten und Fehlern sind. Unbestreitbar zu bemängeln ist die geringe Ausstattungsqualität; zu dunkle und zu kleine Schwarzweiß-Abbildungen auf für diesen Zweck unzureichendem Papier beeinträchtigen die Attraktivität beträchtlich.
Diese Veröffentlichung hinterlässt einen bestenfalls zwiespältigen Eindruck. Als Reiseführer (?), der laut Vorwort des Autors einladen soll, die Kontraste des Ruhrgebiets kennen zu lernen, gehört sie zu der in den letzten Jahren wuchernden Gruppe von „Faszination Ruhrgebiet“- Bild- und Textbänden, die mit selten neuen Erkenntnissen und Bildern an immer dieselben Stätten des Ruhrgebiets heranführen, die man unbedingt vor dem eigenen Ableben noch gesehen haben muss. In dem vorliegenden Band werden 44 Standorte in Kurztexten beschrieben, von denen lediglich etwa ein Viertel nicht zum Standardprogramm eines Ruhrgebietsreiseführers gehört (z.B. Unperfekthaus in Essen, Berne-Park in Bottrop, Hochzeitsmeile in Marxloh). Ein Infokasten gibt für jedes Objekt eine Anfahrtsbeschreibung oder eine Post- oder Web-Adresse an; hinzu tritt eine kartographisch gänzlich unzureichende Übersichtskarte, die jedoch nur die administrativen Grenzen des Ruhrgebiets, aber keines der angesprochenen Objekte verzeichnet. Man kann die Veröffentlichung vielleicht auch als eine Sammlung von subjektiven Kurzessays des Autors ansehen, mit der das Interesse von externen Besuchern geweckt werden soll, die jedoch nicht frei von Ungenauigkeiten und Fehlern sind. Unbestreitbar zu bemängeln ist die geringe Ausstattungsqualität; zu dunkle und zu kleine Schwarzweiß-Abbildungen auf für diesen Zweck unzureichendem Papier beeinträchtigen die Attraktivität beträchtlich.